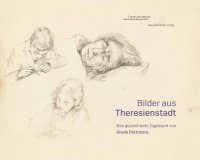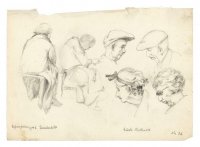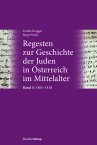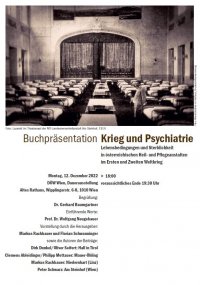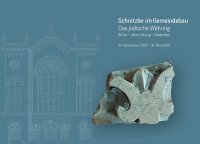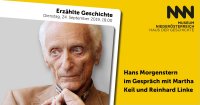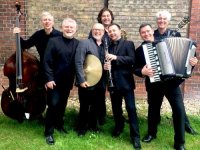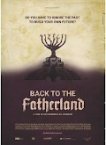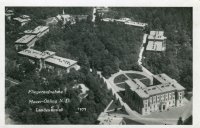Archiv
Abseits großer Gemeinden – Kleine jüdische Siedlungen im Mittelalter
Beyond Large Communities – Small Jewish Settlements in the Middle Ages
4.–6. April 2024
Universität Klagenfurt, Stiftungssaal der Kärntner Sparkasse (O.0.0.1)
Eine Tagung des Instituts für Geschichte an der Universität Klagenfurt in Kooperation mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs
Jüdische Kultur im Mittelalter gilt nach wie vor als urbane Kultur: Jüdinnen und Juden siedelten, so gängige Vorstellungen, in Städten. Während die aschkenasische Kultur in großen jüdischen Gemeinden seit langem im Zentrum des Forschungsinteresses steht, ist der Bereich des jüdischen "Landlebens" über weite Strecken noch wenig erforscht. Dies hängt zwar auch mit einer wesentlich schwierigeren Quellenlage für diese Ansiedlungen zusammen, eine zunehmende Zahl von Untersuchungen in den letzten Jahre hat aber gezeigt, dass trotz der insgesamt schmaleren Quellenbasis zahlreiche neue Erkenntnisse zu diesem Thema gewonnen werden können.
|Das Programm finden Sie hier!|
Eine Online-Teilnahme ist möglich.
Leo Holzer. Feuerwehrkommandant in Radlberg und im KZ Theresienstadt
Vortrag und Diskussion mit Dr. Benjamin Grilj
16. Februar 2024, 18 Uhr
Pfarrheim Radlberg, Radlberger Hauptstr. 149, 3105 St. Pölten
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer vermehrten Ansiedlung von Jüdinnen und Juden in Niederösterreich. Bis 1938 bestanden 15 niederösterreichische Kultusgemeinden, die tief in den Regionen verwurzelt waren. Die jüdischen Menschen waren nicht Fremde, sie waren Nachbarn und Freunde, die gemeinsam lebten, arbeiteten und ihre Freizeit miteinander verbrachten. Bis zu ihrem Ausschluss waren Jüdinnen und Juden auch in Vereinen des Dorfes integriert, so auch bei den Feuerwehren.
Kamerad Ing. Leo Holzer, Begründer der Betriebsfeuerwehr der Firma Schüller, war einer von ihnen. Anhand seines Schicksals wird die jüdische Geschichte der Region nachgezeichnet.
Teilnahmegebühr: Freiwillige Spenden
Information bei Mag. Johann Bruckner: 0650 3828489
Eine Veranstaltung in Kooperation mit Dorferneuerung Radlberg, dem Katholischen Bildungswerk Radlberg, der FF Unterradlberg und der FF Oberradlberg
Auschwitz gedenken
Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich und das Injoest präsentieren bisher unveröffentlichte Bilder und Texte zur Schoah
30. Jänner 2024, 18:30
Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
Programm
Begrüßung
Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Benjamin Grilj (Injoest)
Vorstellung des Ausstellungskatalogs „Bilder aus Theresienstadt – Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara“
Elfriede Kreuzer (Familienarchiv Kreuzer/Kerpen)
Zu den Zeichnungen
Michael Resch (Landessammlungen Niederösterreich)
Berichte aus Auschwitz von Otto Kalwo – aus dem Nachlass von Walter Fantl-Brumlik
Moderation
Martha Keil (Injoest) und Christian Rapp (Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich)
Musikalischer Rahmen
Taner Türker: Drei Stücke für Violoncello solo des 1938 aus Wien vertriebenen Komponisten Egon Wellesz
Freier Eintritt. Für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung ist das Haus der Geschichte von 17:00-18:30 Uhr geöffnet.
Anmeldung erbeten unter +43 2742 90 80 90-998 oder |mail: info@museumnoe.at|
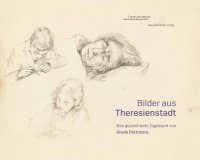
Bilder aus Theresienstadt – Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara (1873–1943)
Ausstellung
10. 10. – 22. 12. 2023
Mo - So, 7.30-12.30 und 13-17 Uhr
Bildungshaus St. Hippolyt
Eybner Straße 5, 3100 St. Pölten
Gisela Rottonara, geb. Tauber, wurde am 10. Juli 1942 in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und erlag den katastrophalen Bedingungen am 23. Jänner 1943. In diesem halben Jahr begann sie, ein gezeichnetes Tagebuch zu führen. Unmittelbar vor ihrem Tod übergab sie 67 Bleistiftzeichnungen einer Mitgefangenen, sie sind seither in Familienbesitz. 150 Jahre nach ihrer Geburt und 80 Jahre nach ihrem Tod werden diese eindrucksvoll genauen und berührenden kleinen Bilder erstmals öffentlich präsentiert.
Kuratierung: Dr. Benjamin Grilj
Gestaltung: Mag. Renate Stockreiter
In Kooperation mit Dr. Rosemarie Burgstaller (Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)
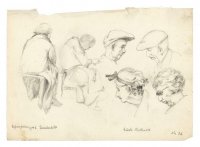
35 Jahre Injoest – zu Gast im Jüdischen Museum Wien
30. 11. 2023, 18.30
Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien (Einlass 18.00 Uhr)
Merle Bieber und Janina Böck-Koroschitz präsentieren ihre Dissertationsprojekte:
- „Koschere“ Lederhosen, „jüdische“ Dirndln? Das Tragen von Tracht als Repräsentation der Zugehörigkeit in Wien und Niederösterreich zwischen Aufkommen der Sommerfrische und 1938
Kernpunkte des Forschungsprojekts bilden einerseits die Funktion der Kleidung in ihrem identitätsstiftenden und Zugehörigkeit erzeugenden Charakter und andererseits die spezielle Bedeutungsmodifikation der Tracht – von ihrer ursprünglichen, allgemeinen Bedeutung als Gewand bis zur Zuschreibung als Kleidung des „einfachen Landvolkes".
- Hachschara. Die Vorbereitung jüdischer Jugendlicher in Österreich für die Auswanderung nach Palästina/Erez Israel
Das Forschungsvorhaben erforscht die Entstehungsgeschichte, den Verlauf, die agierenden Organisationen und Personen sowie die Wirkungsgeschichte der österreichischen Hachschara, die ab den 1920er Jahren österreichisch-jüdischen Jugendlichen die Auswanderung ermöglichen wollte.
Durch den Abend führt Martha Keil.
Eintritt frei! Bitte melden Sie sich |beim JMW| an.

Antijüdische Motive und Stereotype im Mittelalter
Vortrag von Martha Keil
10. 11. 2023, 18.30
Stephansplatz 3, 1010 Wien
Vortrag im Rahmen der Theologischen Kurse, Spezialkurs Antisemitismus. Zum Verständnis eines sehr alten und zugleich aktuellen Problems
Gedenken braucht Forschung
Zum Jahrestag der Novemberpogrome
9. 11. 2023, 18.30
Bildungshaus St. Hippolyt
Eibnerstraße 5, 3100 St. Pölten
Martha Keil
Neue Steine der Erinnerung in St. Pölten
Benjamin Grilj
Der St. Pöltner Stadtbaumeister Rudolf Tintner und sein Tagebuch aus Theresienstadt
Benjamin Grilj
Führung durch die Ausstellung „Bilder aus Theresienstadt 1942–1943. Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara (1873–1943)“
Anschließend entzünden wir bei einigen Steinen der Erinnerung Gedenklichter und legen weiße Rosen nieder.
Anmeldung unter |mail: office@injoest.ac.at|
In Kooperation mit dem Bildungshaus St. Hippolyt. Weitere Informationen finden Sie |hier|!
Solidargemeinschaft mit Israel
Bei der Solidaritätsveranstaltung des Landes Niederösterreich für Israel durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein von Konsul Herzel Edri hielt auch Martha Keil eine kurze Rede. Sie finden Sie |hier|.
Einen Bericht in der NÖN vom 25. 10. 2023 zur Veranstaltung finden Sie |hier|.
Bilder aus Theresienstadt 1942–1943 – Das gezeichnete Tagebuch von Gisela Rottonara (1873–1943)
Eröffnung der Ausstellung
9. 10. 2023, 18.30
Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, Eybner Straße 5
Gisela Rottonara, geb. Tauber, wurde am 10. Juli 1942 in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und erlag den katastrophalen Bedingungen am 23. Jänner 1943. In diesem halben Jahr begann sie, ein gezeichnetes Tagebuch zu führen. Unmittelbar vor ihrem Tod übergab sie 67 Bleistiftzeichnungen einer Mitgefangenen, sie sind seither in Familienbesitz. 150 Jahre nach ihrer Geburt und 80 Jahre nach ihrem Tod werden diese eindrucksvoll genauen und berührenden kleinen Bilder erstmals öffentlich präsentiert.
Musikalischer Rahmen: Philipp Kronbichler, Klavier
Wir ersuchen Sie um Anmeldung unter |mail: office@injoest.ac.at|, vielen Dank!
Weitere Informationen finden Sie |hier|!
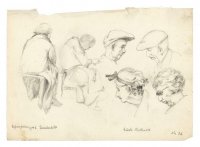
In memoriam Manfred Wieninger
Unter dem Titel „Wirbel der Zeit - Verfolgung und Widerstand in Niederösterreich“ hat die Theodor Kramer-Gesellschaft ein Buch mit Artikeln des verstorbenen St. Pöltner Autors Manfred Wieninger veröffentlicht.
Wieningers Schreiben war immer, ob nun in seinen Kriminalromanen, Aufsätzen zur Zeitgeschichte oder seiner dokumentarischen Prosa, dem Aufdecken des Verdrängten verpflichtet. Dieses Wiedergewinnen des Gedächtnisses führt er uns nicht als traurige Pflicht vor, sondern als dramatische Bereicherung des durch dumpfe Ahnungslosigkeit reduzierten Lebens. Ein Schwerpunkt seiner Recherchen galt Menschen, die verfolgten Juden beizustehen suchten. Wieninger benennt die unentschuldbaren Verbrechen, doch würdigt er auch die moralische Kraft des Mitleids. Viele seiner aufwühlenden Themen fand er „vor der Haustüre“, im heimatlichen St. Pölten. 2021 verstarb der Publizist, Historiker, Schriftsteller und Magistratsmitarbeiter.
Die Präsentation des neuen Buches findet am 29. September, um 18.30 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten statt.
Um Rückmeldung unter 02742/333-2602 oder unter |mail: kultur@st-poelten.gv.at wird gebeten.

Injoest beim Höfefest St. Pölten
Was Sie schon immer zur jüdischen Geschichte Österreichs wissen wollten…
23. 9. 2023, ab 15:00
LöwInnenhof, Linzer Straße 16
- Ab 15:00: Objekte, Bücher, Filme und Informationen zur Arbeit des Injoest
- 15:00-17:00: Klesmer vom Feinsten: Roman Grinberg, Tasten; Sasha Danilov, Klarinette
Allgemeine Informationen zum Höfefest finden Sie hier: |Höfefest St. Pölten|
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ist das jüdisch? Was ist „jüdisch“?
Besuchen Sie uns beim Forschungsfest Niederösterreich 2023!
22. 9. 2023, 13:00-21:00
Palais Niederösterreich
Herrengasse 13, 1010 Wien
Bei uns kann man Gegenstände kennenlernen, die mit jüdischer Geschichte und Kultur zu tun haben – aber was macht sie zu „jüdischen“ Dingen? Religiöser Gebrauch? Jüdische Besitzer/innen? Die Mitnahme im Fluchtgepäck? Die Erinnerung an die Heimat?
Anhand von Biographien, Fotos und einigen Objekten erforschen wir die Bedeutung von Dingen in Geschichte und Gegenwart.
Eintritt frei!
Weitere Informationen zum Forschungsfest finden Sie |hier|!

Europäische Tage der jüdischen Kultur
3. September 2023
14:00 Uhr
Der neue jüdische Friedhof in St. Pölten
Geführter Rundgang durch den neuen jüdischen Friedhof mit Dr. Christoph Lind
Eine Anmeldung ist bis 1. September 2023 unter |mail: office@injoest.ac.at| erforderlich!
Treffpunkt 14:00, neuer jüdischer Friedhof, Karlstettner Straße 3. Teilnahme kostenlos.
Herren bitte mit Kopfbedeckung.
3. September 2023
15:45 Uhr
Steine der Erinnerung
Geführter Rundgang durch die Innenstadt mit Dr. Christoph Lind
Eine Anmeldung ist bis 1. September 2023 unter |mail: office@injoest.ac.at |erforderlich!
Treffpunkt 15:45, Rathaus, Rathausplatz 1. Teilnahme kostenlos.
Das Gesamtprogramm der Europäischen Tage der jüdischen Kultur finden Sie |online |hier oder als |Download|.
In Kooperation mit der |Burgenländische Forschungsgesellschaft|.
Die Gerechten. Courage ist eine Frage der Entscheidung
Sonderausstellung im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
19. April – 15. August 2023
Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
|http://gerechte.at/die-ausstellung/| / |https://yad-vashem.net/| / |www.museumnoe.at|

Kleider machen Juden. Jüdische Kleidung, Mode und Textilproduktion zwischen Selbstbestimmung und Zwang
32. Internationalen Sommerakademie
5.-7. Juli 2023
Volkskundemuseum Wien
Kleidung ist seit jeher ein semantischer Code, der gelesen und entschlüsselt werden kann. Sie erlaubt unmittelbar eine soziale Kategorisierung, die sich stets zwischen Freiheit und Zwang bewegt. Während sie in der Vormoderne vor allem von äußeren Vorgaben definiert wurde, ist sie in der Moderne und Gegenwart zunehmend Ausdruck selbstbestimmter Identität. Bei Minderheiten und historisch marginalisierten Gruppen wie Jüdinnen und Juden geht es in besonderem Maße auch um Sichtbarkeit, die teils von außen bestimmt und teils selbst gewählt wird. Die innerjüdische Aufklärung (Haskala) und die Gewährung bürgerlicher Rechte revolutionierten jüdisches Leben und damit auch Kleidung, wobei der Wunsch nach Teilhabe und Gleichberechtigung deutlich zum Ausdruck kam. Die Tagung diskutiert Kleidung, Mode und Textilproduktion als Aspekt jüdischer Kultur, aber auch im Kontext von Migration, Flucht und Holocaust.
|Hier finden Sie das Programm!|
Konzept: Merle Bieber, Benjamin Grilj, Martha Keil
Organisation: Sabine Hödl
Ehrenschutz: Leslie Bergman
In Kooperation mit dem Volkskundemuseum Wien.
Unterstützt durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, den Zukunftsfonds der Republik Österreich, die Stadt Wien, das Land Niederösterreich und die Österr. Gesellschaft für politische Bildung.

Workshops für Citizen Scientists
zum Projekt |NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich|
In der NS-Zeit waren in fast allen Betrieben und Bauernhöfen Zwangsarbeiter/innen eingesetzt. Sowohl diese lagerähnlichen Unterbringungen als auch die großen KZ- und Kriegsgefangenenlager brachten Kontakte und sogar Beziehungen zur lokalen Bevölkerung mit sich, die kaum in offiziellen Dokumenten zu finden sind. Mit der Hilfe von lokalen Citizen Scientists will das Forschungsprojekt „NS-Volksgemeinschaft und Lager“ des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten) und der Universität für Weiterbildung Krems diesen weitgehend vergessenen Aspekt der Geschichte in Erinnerung rufen.
Zur gemeinsamen Information, Diskussion und Recherche finden in den kommenden Wochen weitere Workshops statt:
Die aktuellen und vergangenen Workshop-Termine finden Sie |hier|!
35 Jahre Injoest – zu Gast im ...
24. 5. 2023, 18 Uhr
Führung auf dem neuen Jüdischen Friedhof St. Pölten
PD Dr. Martha Keil
Treffpunkt: Eingang Jüdischer Friedhof, Karlstettner Str. 3
Die Gerechten. Courage ist eine Frage der Entscheidung
Ausstellungseröffnung
18. April 2023, 18:30 Uhr
Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
Sie haben trotz der Gefahr schwerster Strafen Menschen versteckt oder außer Landes gebracht, Papiere gefälscht oder Befehle missachtet. „Gerechter unter den Völkern“ ist ein offizieller Titel, den die Internationale Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem Jerusalem im Auftrag des Staates Israel an Nichtjuden verleiht, die während des Holocaust ihr Leben aufs Spiel setzten, um Jüdinnen und Juden zu retten.
Die Österreichischen Freunde von Yad Vashem präsentierten die Lebensgeschichten dieser mutigen Menschen in einer Wanderausstellung welche bereits in zahlreichen Museen in ganz Österreich zu sehen war.
Das Haus der Geschichte zeigt in Kooperation mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs diese Ausstellung nun erstmals in Niederösterreich.
Die von Michael John und Albert Lichtblau kuratierte Schau wird von Martha Keil, Christian Rapp und Benedikt Vogl um Biografien von „Gerechten“ aus Niederösterreich ergänzt.
Zur Ausstellung sprachen
mehr...
- Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
- Christian Rapp, Wissenschaftlicher Leiter Haus der Geschichte
- Martha Keil, Wissenschaftliche Leiterin Injoest
- Michael John, Österreichische Freunde von Yad Vashem, Johannes Kepler Universität Linz, Historiker und Kurator der Ausstellung
- Gustav Arthofer, Vorsitzender der Österreichischen Freunde von Yad Vashem
- Angelica Bäumer, Kunsthistorikerin und Zeitzeugin
...weniger

Gedenken zu 85 Jahre „Anschluss“
14. März 2023, 18.00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2, 3100 St. Pölten
Wir gedenken in vier Kurzvorträgen der lebensverändernden Zäsur, die der 12. März 1938 für die österreichischen Jüdinnen und Juden bedeutete. Martha Keil macht in ihrer Einführung Erinnerungen von St. Pöltner Jüdinnen und Juden hörbar. Philipp Mettauer zeigt und kommentiert bisher unveröffentlichtes Filmmaterial über die Fahrt deutscher Truppen und ihrer österreichischen Helfer und Helferinnen durch die St. Pöltner Innenstadt. Merle Bieber widmet sich dem Antisemitismus in den niederösterreichischen Urlaubsorten. Zwar waren die Jüdinnen und Juden bereits ab den 20er Jahren mit einer neuen Art des Antisemitismus konfrontiert, doch nach dem „Anschluss“ waren sie in den Sommerfrischeorten nicht mehr erwünscht. Schließlich erinnert Benjamin Grilj anhand der Einträge in den Sterbebüchern 1938 an eine völlig vergessene Opfergruppe: an diejenigen, die in Verzweiflung und Angst ihrem Leben ein Ende setzten.
Programm
mehr...
- Thomas Pulle: Begrüßung
- Martha Keil: Nicht nur in St. Pölten. 85 Jahre nach dem „Anschluss“
- Philipp Mettauer: Des Führers Mittagsrast in St. Pölten. Der „Anschluss“ am 14. März 1938
- Merle Bieber: „Judenfrei”. Sommerfrische-Antisemitismus vor und nach dem „Anschluss” Österreichs
- Benjamin Grilj: Unfreiwillige Selbsttötung. Auswirkungen der NS-Pogrome in jüdische Wohnzimmer
Danach dürfen wir Sie zu einem Glas Wein einladen.
Anmeldung bis 12. 3. 2023 erbeten an |mail: office@injoest.ac.at|!
Wir danken dem Stadtmuseum St. Pölten für die Kooperation.
Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „35 Jahre Injoest – zu Gast im .....”!
...weniger
Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich – Buchpräsentation Band 5
2. März 2023, 18:00
Sommerrefektorium im Bistumsgebäude
Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Aus dem Mittelalter sind in Österreich zahlreiche Urkunden zur jüdischen Geschichte überliefert. Diese wichtigen Quellen werden seit vielen Jahren im Projekt „Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich“ publiziert. Zum Erscheinen des fünften Bandes der Reihe stellen die Autorinnen das Forschungsunternehmen vor und präsentieren einige besonders spannende Stücke aus dem neuen Buch.
Programm
mehr...
- Thomas Aigner & Martha Keil: Begrüßung
- Eveline Brugger: „Ein langwieriges und entsagungsvolles Unterfangen“ – eine Projektvorstellung
- Birgit Wiedl: Von Juden und Wein. Jüdischer Weinbau im mittelalterlichen Niederösterreich
Danach dürfen wir Sie zu einem Glas Wein einladen.
Anmeldung bis 27.2.2023 erbeten unter |mail: office@injoest.ac.at|!
Wir danken der Diözese St. Pölten für die Kooperation und dem FWF für die Unterstützung des Projekts.
Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „35 Jahre Injoest – zu Gast im .....”!
...weniger
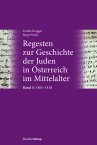

Workshops für Citizen Scientists
zum Projekt |NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich|
In der NS-Zeit waren in fast allen Betrieben und Bauernhöfen Zwangsarbeiter/innen eingesetzt. Sowohl diese lagerähnlichen Unterbringungen als auch die großen KZ- und Kriegsgefangenenlager brachten Kontakte und sogar Beziehungen zur lokalen Bevölkerung mit sich, die kaum in offiziellen Dokumenten zu finden sind. Mit der Hilfe von lokalen Citizen Scientists will das Forschungsprojekt „NS-Volksgemeinschaft und Lager“ des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten) und der Universität für Weiterbildung Krems diesen weitgehend vergessenen Aspekt der Geschichte in Erinnerung rufen.
Zur gemeinsamen Information, Diskussion und Recherche werden im Jänner und Februar 2023 in einigen Gemeindebliotheken erste Workshops mit dem Projektteam stattfinden. Wenn Sie Dokumente, Fotos und Erinnerungen aus Ihrer Familie beitragen oder mit uns gemeinsam forschen wollen, sind Sie herzlich willkommen!
Anmeldung erbeten an |mail: Tina Frischmann|.
Workshoptermine
mehr...
Krems an der Donau
20.01.2023, 18:00 – 19:30
Seminarraum SE C 2.01 (Neubau), Universität für Weiterbildung Krems, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems
Edith Blaschitz, Karin Böhm, Tina Frischmann
St. Pölten
21.01.2023, 14:00 – 15:30
Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2, 3100 St. Pölten
Vorstellung des Forschungsprojekts UND des Buch- und Ausstellungsprojekts „St. Pölten im Nationalsozialismus” (siehe unten)
Tina Frischmann, Christoph Lind, Martha Keil, Janina Böck-Koroschitz, Thomas Pulle, Thomas Lösch, Niklas Perzi
Eichgraben
25.01.2023, 18:00 – 19:30
Gemeindebücherei Eichgraben, Rathausplatz 1, 3032 Eichgraben
Janina Böck-Koroschitz, Tina Frischmann, Christoph Lind
Neulengbach
02.02.2023, 18:00 – 19:30
Stadtbibliothek Neulengbach, Rathausplatz 1, 3040 Neulengbach
Janina Böck-Koroschitz, Tina Frischmann, Christoph Lind
Sitzenberg Reidling
15.02.2023, 18:00-19:30
Öffentliche Bücherei Sitzenberg-Reidling, Leopold Figl Platz 3, 3454 Sitzenberg-Reidling
Tina Frischmann, Martha Keil, Christoph Lind
Loosdorf
16.02.2023, 18:00 – 19:30
Öffentliche Bücherei Loosdorf: Wachaustraße 1, 3382 Loosdorf
Tina Frischmann, Philipp Mettauer
Wilhelmsburg
21.02.2023, 18:00 – 19:30
Stadtbibliothek Wilhelmsburg, Penknergasse 5, 3150 Wilhelmsburg
Tina Frischmann, Christoph Lind, Philipp Mettauer
Krems an der Donau – 2. Workshop
23.02.2023, 18:00 – 19:30
Seminarraum SE 2.4 (Altbau), Universität für Weiterbildung Krems, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems
Edith Blaschitz, Karin Böhm, Tina Frischmann
Traisen
27.02.2023, 18:00-19:30
Öffentliche Bücherei der Marktgemeinde Traisen, Gemeindeamt Traisen 1. Stock (ohne Lift, Eingang hofseitig), Mariazeller Straße 78, 3160 Traisen
Tina Frischmann, Philipp Mettauer
Eichgraben – 2. Workshop
01.03.2023, 18:00 – 19:30
Gemeindebücherei Eichgraben, Rathausplatz 1, 3032 Eichgraben
Janina Böck-Koroschitz, Tina Frischmann, Christoph Lind
...weniger
Vier Schwestern. Fernes Wien, fremde Welt – Buchpräsentation und Podiumsgespräch
14. Februar 2023, 18:30
Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
Ilse, Gerda, Friedl und Susanne waren die begabten und eigenständigen Töchter von Irma und Ernst Benedikt, dem Herausgeber der einflussreichen „Neuen Freien Presse“. Aus tausenden Briefen und Dokumenten rekonstruierte der Kulturwissenschaftler und Publizist Ernst Strouhal die Schicksale seiner Großeltern, Mutter und Tanten nach der Vertreibung durch die Nationalsozialisten. Die Briefe der Schwestern erzählen unsentimental berührend vom Verlust von Heimat, Vermögen, Sprache und Kultur und von den Lebenskämpfen an den jeweiligen Zufluchtsorten.
Im Gespräch mit der Historikerin und Judaistin Martha Keil stellt der Autor Ernst Strouhal seine im Sommer 2022 im Zsolnay-Verlag erschienene Familiengeschichte vor.
Im Anschluss dürfen wir Sie zu einem Glas Wein bitten.
Eintritt frei, Anmeldung erbeten: 02742 90 80 90-998 oder |mail: anmeldung@museumnoe.at|
Wir danken dem Museum Niederösterreich für die Kooperation.
Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „35 Jahre Injoest – zu Gast im .....”!

Projektvorstellungen
21.1.2023, 14:00-15:30
Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2
Vorstellung des Forschungsprojekts „|NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich|”
und des Buch- und Ausstellungsprojekts „St. Pölten im Nationalsozialismus”
Die Veranstaltung richtet sich an ZeitzeugInnen, an zeitgeschichtlich interessierte MitbürgerInnen, hier vor allem auch an junge und junggebliebene ForscherInnen im Sinne der Citizen Science, die im eigenen Wirkungskreis tiefer in diese folgenschwere Epoche eindringen wollen. Bringen Sie Anschauungsmaterial, über das Sie näher Bescheid wissen wollen!
Programm
mehr...
- Begrüßung: Thomas Pulle, Martha Keil
- Zum Forschungsprojekt „NS-„Volksgemeinschaft” und Lager im Zentralraum Niederösterreich“: Christoph Lind
- Impulsreferat zum Buch- und Ausstellungsprojekt „St. Pölten im NS“: Thomas Lösch
- Moderation: Tina Frischmann
Im Anschluss haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Fragen an die anwesenden ExpertInnen zu stellen.
Als AnsprechpartnerInnen stehen zur Verfügung: Dr. Martha Keil, Tina Frischmann, Dr. Christoph Lind, Dr. Philipp Mettauer (Institut für jüdische Geschichte Österreichs), Mag. Niklas Perzi (Zentrum für historische Migrationsforschung St. Pölten), Mag. Thomas Lösch (Stadtarchiv St. Pölten) sowie Mag. Thomas Pulle (Stadtmuseum St. Pölten).
...weniger
Vertriebene Nachbarn. Jüdische Regionalgeschichte im Mostviertel
Vortrag von Martha Keil zum Tag des Judentums
18. 1. 2023, 19.30
Bildungshaus Seitenstetten, Promenade 13, 3353 Seitenstetten
1881 gründete sich in Amstetten eine Israelitische Kultusgemeinde, die die Bezirke Amstetten, Scheibbs, Persenbeug, Mank, Ybbs und die Stadt Waidhofen/Ybbs umfasste. 1934 zählte sie 348 Mitglieder. Zum Tag des Judentums referiert Dr. Martha Keil, Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten), zu den Einrichtungen der Gemeinde, dem zunehmenden Antisemitismus, zu den Schicksalen der Jüdinnen und Juden des Mostviertels und zu den Aktivitäten der Forschung und des Gedenkens an die Vertriebenen und Ermordeten.
Weitere Details finden Sie |hier|.
Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling 1914–1945
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer im Rahmen der Buchpräsentation |Krieg und Psychiatrie|
12. 12. 2022, 18:00
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes Wien
Altes Rathaus, Wipplingerstr.6-8, 1010 Wien
Programm
Begrüßung: Gerhard Baumgartner
Einführende Worte: Wolfgang Neugebauer
Vorstellung des Bandes durch die Herausgeber Markus Rachbauer und Florian Schwanninger sowie die Autoren:
- Peter Schwarz: Die Heil- und Pflegeanstalt Wien-Steinhof im Ersten und Zweiten Weltkrieg
- Dirk Dunkel/Oliver Seifert: Die Heil- und Pflegeanstalt Hall in Tirol in den beiden Weltkriegen. Sterblichkeit und Lebensbedingungen im Vergleich
- Clemens Ableidinger und Philipp Mettauer: Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Ohling 1914–1945
- Markus Rachbauer: Zwischen Heilanstalt und Tötungsort – zum Massensterben von PatientInnen der psychiatrischen Anstalt Niedernhart (Linz) während der beiden Weltkriege
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich.
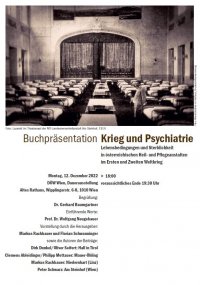
Gedenken braucht Forschung
Zum Jahrestag der Novemberpogrome
Mittwoch, 9. November 2022, 19 Uhr
Bildungshaus St. Hippolyt
mehr...
-
Dr. in Martha Keil und Mag. Mag. (FH) Erich Wagner-Walser: Begrüßung
-
Mag. Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ: Grußwort
-
Dr. Christoph Lind: Publikation zur Ausstellung „Bruch und Brücke“
-
Dr.in Martha Keil: Steine der Erinnerung 2022 und Citizen Science-Projekt zu NS-Lagern in Niederösterreich
Anschließend können bei den Steinen der Erinnerung in der Innenstadt Grablichter entzündet und weiße Rosen gelegt werden.
Veranstaltet vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs. Die Teilnahme ist kostenlos.
Information und Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at,| 02742 77171-0 (Mo-Fr 9:30-13:00 Uhr)
Memorbuch: |www.juden-in-st-poelten.at|
...weniger

Die verdrängten Toten – NS-Euthanasie in Mauer-Öhling
Film und Gespräch
Dienstag, 8.11.2022, 20 Uhr
|Cinema Paradiso St. Pölten|
mehr...
Mindestens 30.000 Menschen wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich als „unwertes Leben” qualifiziert und im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet. Während Schloss Hartheim, die Nervenkliniken Am Spiegelgrund/Am Steinhof und Gugging mittlerweile als Schauplätze nationalsozialistischer Medizinverbrechen bekannt sind, ist eine der größten Mordstätten mit bis zu 2.400 Opfern lange Zeit weitgehend unerforscht geblieben: die “Heil- und Pflegeanstalt” Mauer-Öhling bei Amstetten.
Der Dokumentarfilm, der auf langjährigen Forschungen des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs beruht, macht diese bisher unbekannte Geschichte erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und erzählt die Geschichte dieses vergessenen NS-Verbrechens anhand exemplarischer Biografien von Patientinnen und Patienten, Tätern und Mitwissenden.
Nach dem Film Gespräch mit Regisseur Alexander Millecker
...weniger

Vernetzt forschen. Berichte aus der first-Werkstatt
Montag, 3. Oktober 2022, 16 Uhr
Niederösterreichische Landesbibliothek, St. Pölten
Programm
mehr...
16:00–16:15 Uhr: Begrüßung
Martina Höllbacher, Leiterin Abteilung Wissenschaft und Forschung, Land Niederösterreich
Roman Zehetmayer, Leiter NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek
Martha Keil & Johannes Pflegerl, Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first)
16:15-16:45 Uhr: Janina Böck-Koroschitz, Dieter Bacher: Lager in Niederösterreich als Gegenstand der Forschung anhand des Beispiels der Hachschara-Lager
16:45-17:15 Uhr: Oliver Kühschelm, Jessica Richter & Anne Unterwurzacher: Viele Wege und neue Spuren im Archiv: Migrationsforschung bei first
17:15-17:45 Uhr Thomas Kühtreiber: Klosterhöfe in der Wachau: Regionsbildung durch Weinbau?
ab 17:45 Uhr: Umtrunk
|Hier finden Sie den Prgrammfolder|.
Veranstaltungsort:
Niederösterreichische Landesbibliothek,
Franz-Schubert-Platz 1-4, 3100 St. Pölten
Veranstalter:
Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first) in Kooperation mit dem Niederösterreichischen Landesarchiv, dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde und der Niederösterreichischen Landesbibliothek
Anmeldung:
Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos, um Anmeldung bis zum 26. September 2022 wird gebeten!
Anmeldung unter: Daniela Wagner, |mail: daniela.wagner@donau-uni.ac.at|, Tel.: 02732 893-2553
...weniger

Bruch und Brücke. Niederösterreich und „seine“ Juden 1922–2022
Ausstellung
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
Öffnungszeiten der Ausstellung
6. Mai – 1. Oktober 2022, Fr–So, 14.00–19.00
Anmeldungen für Besuche außerhalb der Öffnungszeiten: |mail: office@injoest.ac.at|
mehr...
Anhand der St. Pöltner jüdischen Familie Löw zeigt die Ausstellund die letzten 100 Jahre aus jüdischer Perspektive. Zehn Stationen bringen einerseits das Wirken vieler Jüdinnen und Juden für ihre Heimatgemeinden und den brutalen Bruch durch Vertreibung und Ermordung näher. Andererseits zeigen sie den vorsichtigen Brückenschlag zwischen den Vertriebenen und Nachkommen und ihren Herkunftsorten, den das Land NÖ durch seine Förderung von Forschung zur jüdischen Geschichte und von Zeichen der Gedenkkultur ermöglicht.
Idee: Martha Keil | Kurator: Christoph Lind | Gestaltung: Renate Stockreiter
...weniger

Lange Nacht der Museen
Samstag, 1. Oktober 2022
Ehemalige Synagoge St. Pölten
18.00 Begrüßung durch Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
18.10 Nicht nur in St. Pölten. Synagogen in der österreichischen Geschichte. Kurzvorträge von Mitgliedern des Injoest-Teams
- Eveline Brugger: Prügel in der Synagoge. Die Eskalation eines Streits in der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde von Regensburg
- Martha Keil: Stibln und Tempel: Gebetsräume und Bethäuser in der „Zwischenzeit“ 1500-1848
- Benjamin Grilj: Bürokratie im Bet Knesset. Synagoge und staatliche Verwaltung
- Philipp Mettauer: „Thorarolle: Bestimmungsland Amerika“
mehr...
19.30 Jiddische Lieder über die Zeit hinaus
Isabel Frey: Gesang, Gitarre
Benjy Fox-Rosen: Gesang, Kontrabass
Ivan Trenev: Akkordeon
Das bunte Programm wechselt zwischen traditionellen Liedern, „Greatest Hits“, zeitgenössischen jiddischen Liedern aus der Klezmer-Revival Bewegung sowie eigenen Vertonungen von jiddischer Poesie. Jenseits von Kitsch und Nostalgie schaffen die Musiker/innen so ein musikalisches Erlebnis, in dem Jiddisch nicht Teil einer verlorenen Welt der Vergangenheit, sondern einer lebendigen kulturellen Tradition ist.
21.30 UND 22:30 Ausstellung „Bruch und Brücke. Niederösterreich und ,seine‘ Juden 1922–2022“
Führung mit Kurator Christoph Lind (Treffpunkt: Frauengalerie rechte Seite)
Nicht nur für Kinder: Mach dir einen Synagogen-Button!
Nicht nur für Erwachsene: Orientalische Köstlichkeiten von Lorenz famos!
...weniger

Die verdrängten Toten - NS Euthanasie in Mauer-Öhling
Dokumentarfilm und Gespräch
Do., 22. September 2022, 19:30
BildungsZentrum St. Benedikt, Promenade 13, 3353 Seitenstetten
Mindestens 30.000 Menschen wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich als „unwertes Leben” qualifiziert und im Rahmen der NS-„Euthanasie” ermordet. Während Schloss Hartheim, die Nervenkliniken Am Spiegelgrund/Am Steinhof und Gugging als Schauplätze nationalsozialistischer Medizinverbrechen bekannt sind, war eine der größten Mordstätten des „Dritten Reiches” mit bis zu 2.400 Opfern lange Zeit unerforscht: die „Heil- und Pflegeanstalt” Mauer-Öhling bei Amstetten.
Der Dokumentarfilm, der auf langjährigen Forschungsprojekten des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs beruht, macht diese bisher unbekannte Geschichte erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Exemplarisch soll anhand der Biografien von Patient*innen, Tätern und Mitwissenden die verdrängte Geschichte dieses Ortes sichtbar und verstehbar gemacht werden.
Der Regisseur Alexander Millecker sowie der für die historische Recherche verantwortliche Philipp Mettauer stehen nach dem Film für Fragen zur Verfügung.
Schnitzler im Gemeindebau. Das jüdische Währing. Blüte – Vernichtung – Gedenken
Ausstellung
Mo–Fr 8:00–15:30, Do 8:00–17:30
Amtshaus Währing, Festsaal, 18., Martinstraße 100 – bis 31. August 2022
Kuratorin: Martha Keil | Gestaltung: Renate Stockreiter
Finissage und Präsentation der Broschüre zur Ausstellung
Mittwoch, 7. September 2022, 18.00
Amtshaus Währing, Martinstraße 100, Festsaal
Begrüßung: Bezirksvorsteherin Silvia Nossek
„Was wir nicht zeigen konnten“: Zum Abschluss präsentieren die Kuratorin Martha Keil und die Designerin Renate Stockreiter Fotos, Texte und Abbildungen von Objekten, die aus Platzmangel oder Sicherheitsgründen nicht in die Ausstellung aufgenommen werden konnten.
Die Broschüre liegt künftig in der Bezirksvorstehung und im Bezirksmuseum auf.
„Zedaka“ (hebräisch: Gerechtigkeit) – Jüdische Wohlfahrt und Armenfürsorge bis 1938
31. Internationale Sommerakademie
6. – 8. 7. 2022
Volkskundemuseum Wien
Laudongasse 15-19, 1080 Wien
Das Programm finden Sie |hier|!
Veranstaltungsreihe „Dinge – Menschen – Geschichten“
Kuratorin Martha Keil und Gäste
- 15.12.2021: ABGESAGT
- 19.1.2022: Elizabeth Baum-Breuer, Kathrin Pokorny-Nagel: Die Familie Mautner und das Geymüller-Schlössel
- 16.2.2022: Ronny Zuckermann: Die Maschinenfabrik Moritz Zuckermann’s Witwe
- 16.3.2022: ABGESAGT
- 20.4.2022: Susanne Schober-Bendixen, Jennifer Kickert: Die Familie Redlich und der Währinger jüdische Friedhof
- 18.5.: Filipp Goldscheider: Die Keramikmanufaktur Goldscheider in der Staudgasse 7-9
- 15.6.: Brigitte Ungar-Klein: U-Boote, Gemeindebauten und der Onkel im Tempelchor
Tag des offenen Steinbruchs
3. 6. 2022
Ab 15:00, Stein-Werk-Arena
Wir stellen die Geschichtswerkstatt und das Projekt am historischen Ort vor und informieren über die Geschichte des Steinbruchs. Wir laden ein, Erinnerungen an den Steinbruch mitzubringen – wir sammeln Geschichten, Fotos, Erinnerungsstücke.
Informationen: |Spuren lesbar machen|
Ich bin a balagole
Konzert und Lesung
Ania Vegry —Sopran ι Katarzyna Wasiak — Klavier ι Doron Rabinovici — Rezitation
Der polnische Komponist Simon Laks, im Mittelpunkt der „Zwischentöne Polen” des Festivals Imago Dei 2022, wurde auf vielfältige Weise zum Komponieren von Liedern angeregt. Einerseits fühlte er sich der polnischen Dichtergruppe Skamander nahe, vor allem Julian Tuwim, andererseits wurde er durch zwei Sängerinnen vor und nach dem Krieg zu stilistisch changierenden Liedern inspiriert. Laks verarbeitete seine Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz in mehreren Liedern und schrieb nach dem Krieg „Acht Jüdische Volkslieder” in jiddischer Sprache. Aus diesem Zyklus stammt auch der Titel des Konzertes, „Ich bin a balagole”. „Ich bin ein Kutscher/und fahre ohne End´/ich spiele meine kleine Rolle/ und ich fahre einfach davon.”
In Kooperation mit dem Klangraum Krems / Imago Dei und dem Literaturhaus Salzburg (Simon Laks: Musik in Auschwitz|).
Eintritt frei!

Ärzte und andere Täter*innen. Die NS-„Euthanasie“-Morde in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling
Vortrag von Philipp Mettauer
2.6.2022, 15:30-17 Uhr
Depot, Breitegasse 3, Wien
Biographien als Sonden der Transformation? „Agency“ der NS-Täter:innen nach 1945 in Österreich, der Bundesrepublik und der DDR.
Veranstaltet vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien
Nathan 575
eine Veranstaltung im Rahmen des |Erinnerungsbüros| des Landestheaters Niederösterreich in der Ehemaligen Synagoge
St. Pölten, Dr.-Karl-Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
Premiere Fr 27.5.22, 19:30
Di 31.5.22, 19:30
„Nathan 575“ ist eine besondere Art der theatralen Geschichtsaufarbeitung. In der Ehemaligen Synagoge St. Pölten, dem zentralen Ort des früheren jüdischen Lebens der Stadt, entsteht eine temporäre Bühne.
mehr...
Der renommierte und vielfach ausgezeichnete Filmemacher und Regisseur Ludwig Wüst und seine künstlerische Partnerin Maja Savic bringen mit drei Schauspieler*innen und dem Akkordeonisten Helmut Thomas Stippich Szenen aus G. E. Lessings „Nathan der Weise“ mit den Stimmen jüdischer Zeitzeug*innen aus Niederösterreich in einen Dialog. Sie berichten aus Originaldokumenten wie Briefen und Tagebüchern, und geben Auskunft darüber, wie Jüdinnen und Juden den aufkommenden Nationalsozialismus, die Jahre der Flucht und das Schicksal ihrer Verwandten erlebt haben. Der persönliche Blick der Zeitzeug*innen macht die Dringlichkeit der Lessing’schen Ideale von Toleranz und Aufklärung spürbar und verbindet sie mit Bildern unserer Gegenwart von zerstörerischer Machtpolitik, Flucht und Krieg.
Konzept, Raum und Inszenierung Ludwig Wüst und Maja Savic
Musik Helmut Thomas Stippich
Mit Tobias Artner, Emilia Rupperti, Helmut Thomas Stippich, Helmut Wiesinger
...weniger

The Lower Austrian Psychiatric Hospital Mauer-Öhling during the National Socialist Era
Vortrag von Philipp Mettauer
26.5.2022, 14-14:30 Uhr
Karl-Franzens-Universität, Kultum, Mariahilferplatz 3, Graz
International Conference on Camps, (In)justice and Solidarity in the Americas. Commemoration of the 20th Anniversary of the Guantánamo Bay Detention Camps.
|Weitere Informationen|
Mobile Menschen, Gegenstände und Erinnerung in der jüdischen Geschichte Österreichs
26. April/3./10./17./24. Mai 2022
Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1, 1020 Wien
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung 2022
Konzept: PD Dr. Martha Keil
mehr...
Mobilität aus den unterschiedlichsten Motiven ist eine Grundkonstante der Geschichte und unfreiwilliges Unterwegssein, Flucht und Vertreibung kennzeichnet insbesondere auch die jüdische Geschichte. Mit den Menschen bewegen sich ihre Dinge, sie werden mitgenommen, zurückgelassen, geraubt oder zweckentfremdet und mittels Fotos, Erwähnungen und Ersetzen in Erinnerung gerufen. Die Vortragsreihe behandelt diese Themen in einem langen Zeitraum vom Mittelalter bis in die Gegenwart.
26.4. Birgit Wiedl
Essende, fahrende und liegende Pfänder. Das Pfand als mobiles Objekt im Rahmen jüdisch-christlicher Kontakte
3.5. Martha Keil
Besamimbüchse mit Kreuz? Christliche Objekte mit – wahrscheinlich – jüdischer Geschichte im Mittelalter
10.5. Christoph Lind
Mazzoth, Fleisch und Wein. Koscherer Versandhandel im k. u. k. Wien
17.5. Philipp Mettauer
Materialisierte Erinnerung. „Arisierung” und die Bedeutung der Dinge im Exil
24.5. Merle Bieber
Ein Steirerhut in Edinburgh. Trachtenmode zwischen Verfolgung, Identität und Erinnerung
...weniger
Denkmal für die 1938 bis 1945 vertriebenen Geschichte-Studierenden und -Lehrenden der Universität Wien
Donnerstag, 19.5.2022, 17:00 Uhr
Stiege 2, 1. Stock, neben dem Hörsaal 41, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien
Feierliche Eröffnung des Denkmals, welches unter Mitwirkung von Martha Keil in Beirat und Jury verwirklicht werden konnte.
mehr...
An der Universität Wien wurden mit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus 1938 rund 3.000 vorwiegend jüdische Angehörige der Universität entlassen und in der Folge vertrieben und/oder ermordet – darunter auch 120 Studierende und acht Lehrende des Fachs Geschichte. Die heutigen historischen Institute der Universität Wien stellen sich ihrer Geschichte, indem sie an dieses Unrecht erinnern und ein Denkmal („Wenn Namen leuchten”, künstlerisches Konzept: Iris Andraschek) vor dem zentralen Hörsaal für Geschichte-Studierende errichten, auf dem alle entlassenen, vertriebenen und entrechteten Frauen und Männer nicht nur kollektiv, sondern individuell, namentlich, erinnert werden. Sie werden Teil des kollektiven Gedächtnis- und Erinnerungsraumes der heutigen
Universität, der heutigen Geschichte-Studierenden und -Lehrenden. Das Denkmal ist für Gegenwart und Zukunft als Erinnerung gedacht und zugleich als Mahnung an die Angehörigen der Universität: „Wehret den Anfängen!”
Anmeldungen bitte bis 16. Mai 2022 an: |mail: sabine.koch@univie.ac.at|
Weiteren Informationen finden Sie |online|.
Gleichzeitig dürfen wir auf das Erscheinen der |Begleitpublikation |hinweisen.
Es gelten die aktuellen COVID-19-Schutzmaßnahmen der |Universität Wien|.
...weniger
Die verdrängten Toten: NS-Euthanasie in Mauer-Öhling
ORF III, 8. Mai, 16 Uhr 10
Mindestens 30.000 Menschen wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich als „unwertes Leben” qualifiziert und im Rahmen der NS-Euthanasie ermordet. Während Schloss Hartheim, die Landesnervenklinik Gugging und Am Spiegelgrund/Am Steinhof mittlerweile als Schauplätze nationalsozialistischer Medizinverbrechen bekannt sind, war eine der größten Mordstätten lange Zeit unerforscht: die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling. Bis zu 2.400 PatientInnen wurden ermordet. Der Dokumentarfilm, der auf den Forschungen eines unserer Projekte beruht, macht diese bisher unbekannte Geschichte erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Exemplarisch soll anhand der Biografien von Opfern, TäterInnen und Mitwissenden die verdrängte Geschichte dieses Ortes sichtbar und verstehbar gemacht werden.
Regie: Alexander Millecker
Historische Recherche: Philipp Mettauer
Bruch und Brücke. Niederösterreich und „seine“ Juden 1922–2022
Ausstellungseröffnung
Donnerstag, 5. Mai 2022, 18.30
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22
Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at|
Idee: Martha Keil | Kurator: Christoph Lind | Gestaltung: Renate Stockreiter
mehr...
„Wir wären nicht hier, wenn es Euch Historiker nicht gäbe!“, sagte Karin Rivollet (Genf), Enkelin der in der Shoah ermordeten St. Pöltner Hermann und Irma Löw anlässlich eines Besuchs im Haus der Geschichte im Museum NÖ im Oktober 2021. Anhand ihrer Familie stellt „Bruch und Brücke“ die letzten 100 Jahre aus jüdischer Perspektive dar. Zehn Stationen bringen einerseits das Wirken vieler Jüdinnen und Juden für ihre Heimatgemeinden und den brutalen Bruch durch Vertreibung und Ermordung näher. Andererseits zeigen sie den vorsichtigen Brückenschlag zwischen den Vertriebenen und Nachkommen und ihren Herkunftsorten, den das Land NÖ durch seine Förderung von Forschung zur jüdischen Geschichte und von Zeichen der Gedenkkultur ermöglicht. Karin Rivollet und ihre Schwester Nina Moldauer werden bei der Eröffnung sprechen.
Das musikalische Begleitprogramm ist selbst eine Brücke: ausgewählte Sätze aus Cello-Sonaten von Hans Gál, geboren 1890 in Brunn am Gebirge, 1938 nach England geflüchtet und 1987 in Edinburgh gestorben. Wie so viele andere wurde er nicht nach Österreich zurückgerufen, erst ab den 1970er Jahren erhielt er von der Republik Österreich hohe Auszeichnungen. Es spielt Taner Türker (St. Pölten).
...weniger
NS-„Volksgemeinschaft“ und Lager im Zentralraum Niederösterreich. Geschichte – Transformation – Erinnerung
Auftaktveranstaltung unseres Forschungs- und Citizen Science-Projekts
Donnerstag, 31. 3. 2022, 17.30
NÖ Landesbibliothek, Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten
Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils gültigen Covid-19-Sicherheitsbestimmungen statt, allerdings mit begrenzter Teilnahmezahl und FFP2-Maskenpflicht. Kurzfristige Änderungen teilen wir Ihnen mit. Deshalb bitten wir unter |mail: office@injoest.ac.at um rechtzeitige Anmeldung.
Programm
mehr...
- Begrüßung: PD Mag. Dr. Roman Zehetmayer, Leiter NÖ Landesarchiv und Landesbibliothek
- Grußworte: Bundesrat Florian Krumböck, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
- Zum Projekt: Dr. Martha Keil, Projektleiterin, Institut für jüdische Geschichte Österreichs
- Zur Forschung und Mitarbeit: Dr. Edith Blaschitz, Universität f. Weiterbildung Krems / Ursula Liebmann, Treffpunkt Bibliothek
- Zu Citizen Science: Im NÖ Zentralraum waren in zahlreichen Betrieben und Bauernhöfen Zwangsarbeiter/innen und Kriegsgefangene untergebracht. Wenn Sie Informationen und Erinnerungen einbringen oder mit uns gemeinsam forschen wollen, sind Sie im Projektteam herzlich willkommen! Das Projekt hat durch die Medienberichte bereits großes Interesse gefunden, wir freuen uns daher auf Ihre Fragen und Beiträge! Bitten melden Sie sich unter |mail: office@injoest.ac.at| an, vielen Dank!
Im Anschluss laden wir mit freundlicher Unterstützung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem Glas Wein.
...weniger

Kossow – Wien – Shanghai. The Abraham Family on the run
Montag, 7.3.2022
18:00-19:30 Uhr
Vortrag von Dr. Benjamin Grilj im Rahmen des Vienna Jewish Studies Colloquium, veranstaltet vom Institute for Jewish Studies, University of Vienna
Klicken Sie |hier| für die Registrierung.
Abstract:
mehr...
This lecture will examine the political, legal, and historical dimensions of „ostjüdisch” refugees during World War I, who ended up in Vienna and then later escaped from the Shoah. The focus of the lecture will be the Abraham family from Kossow, Galicia, which found refuge in Vienna during the First World War and then had to emigrate to Shanghai during the Second World War.
...weniger
Spuren lesbar machen im NS-Zwangsarbeitslager Roggendorf/Pulkau
25. Februar 2022
17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)
Stadtsaal, Bahnstraße 4, 3741 Pulkau
Wir stellen das Projekt Spuren lesbar machen im NS-Zwangsarbeitslager Roggendorf/Pulkau und die Geschichtswerkstatt Pulkau im Stadtsaal vor und laden Sie herzlich dazu ein. Informationen: |Spuren lesbar machen|
Für die Veranstaltung gilt die aktuelle COVID 19-Verordnung für Veranstaltungen. Aus diesem Grund ersuchen wir um Anmeldung und um die Einhaltung der geltenden Covid 19-Bestimmungen. Änderungen, die sich aufgrund der aktuellen COVID 19-Situation ergeben, werden bekannt gegeben.
Anmeldung: |mail: buergermeister@pulkau.gv.at|; Tel. Nr.: 0664 3803869

Internationaler Holocaust-Gedenktag
27.1.2022
Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages wollen wir uns an jene jüdischen St. Pöltnerinnen und St. Pöltner erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Wir laden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu ein, die in den letzten Jahren verlegten Steine der Erinnerung gegebenfalls zu reinigen und in individuellem Gedenken weiße Rosen niederzulegen oder Kerzen (bitte ohne christliche Symbolik) aufzustellen.
Die einzelnen Standorte und Kurzbiografien finden Sie |hier|.
Rosen und Kerzen können natürlich auch beim Gedenkstein im Garten der Ehemaligen Synagoge niedergelegt und aufgestellt werden (Zugang über Dr. Karl Renner-Promenade 22 oder Lederergasse 12).
Möge das Andenken der Ermordeten zum Segen sein!
„Zedaka errettet vor dem Tod“. Wohltätigkeit als Rechtsanspruch in der jüdischen Gesellschaft
Vortrag von Martha Keil
Montag, 17. Jänner 2022, 19.00
Bildungshaus St. Hippolyt, St. Pölten, Eybnerstraße 5
Information und Anmeldung beim |Bildungshaus St. Hippolyt|!
Endphase
Dienstag, 11. Jänner 2022, 20.00
Cinema Paradiso St. Pölten, Rathausplatz 13
NÖ-Premiere mit Regisseur Hans Hochstöger
Ö 2021, R: Hans Hochstöger, K: Richard Bayerl, Sch: Christin Veith, M: Victor Gangl, 86 min.
Nach dem Film Diskussion mit Martha Keil und Christoph Lind
In der Nacht vom 2. Mai 1945 wurden 228 jüdische Frauen, Kinder und Männer aus Ungarn in der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Hofamt Priel von bis heute unbekannten Tätern ermordet. Zu einem Prozess kam es nie. Regisseur Hans Hochstöger und sein Bruder Tobias, die dort aufgewachsen sind, machen sich auf die Suche nach einer Erklärung für das Geschehen.
Tickets (€ 8,90): |Cinema Paradiso|

„Unsere Stadt Wien“ – die Anfänge der Wiener jüdischen Gemeinde im Mittelalter
Online-Vortrag von PD Dr.in Eveline Brugger, MAS
25. 11. 2021, 18:00
Achtung: nur Online-Raum
Eine Veranstaltung zum Themenschwerpunkt „1221 - Erstes Wiener Stadtrecht” in Kooperation mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv
Weitere Informationen und den Zoom-Zugang finden Sie |hier|.
Programm
Dr.in Astrid Peterle – Mag.a Adina Seeger – Dr. Domagoj Akrap (Kuratorenteam Jüdisches Museum):
Impulsvortrag: Unser Mittelalter! Zur neuen Dauerausstellung im Museum Judenplatz
PD Mag.a Dr.in Eveline Brugger MAS
Vortrag: „Unsere Stadt Wien“ – die Anfänge der Wiener jüdischen Gemeinde im Mittelalter
Moderation: Dr. Christoph Sonnlechner, MAS
Die jüdische Gemeinde Wiens war am Vorabend ihrer Vernichtung 1420/21 eine der bedeutendsten jüdischen Ansiedlungen im deutschsprachigen Raum; ihre bescheidenen Anfänge liegen allerdings weitgehend im Dunkeln und lassen sich nur dank einiger „Schlaglichter” umrissartig nachzeichnen. Im Lauf des 13. Jahrhunderts ergibt sich durch die zunehmende Zahl von Quellen allmählich ein klareres Bild, das Einblicke in die rechtliche, soziale und wirtschaftliche Lage der Wiener Judenschaft ebenso erlaubt wie in die innere Entwicklung der Gemeindestruktur. Dieser Weg von unklaren Anfängen zur etablierten und florierenden Gemeinde soll ebenso nachgezeichnet werden wie die Entwicklung der Beziehungen dieser Gemeinde zu ihrer christlichen Umgebung.
Gedenken an die Novemberpogrome 1938
Dienstag, 9. November 2021
18.30 Uhr, Ehemalige Synagoge
Briefe von St. Pöltner Opfern der Shoa
Beim Gedenkstein an der Außenmauer können Lichter (bitte ohne religiöse Symbole) entzündet werden.
19.00 Uhr, Bildungshaus St. Hippolyt
Gedenken braucht Forschung
Martha Keil: Neue Steine der Erinnerung in St. Pölten, Gedenktafel für die Familie Fantl-Brumlik in Bischofstetten
Philipp Mettauer: Präsentation der Kurzfilmdokumentation „Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit” (Ostfilm, April 2021)
Anschließend, am Weg zum Rathausplatz, werden im Gedenken weiße Rosen und Grablichter bei den Steinen der Erinnerung platziert.
Mobile Dinge, Menschen und Ideen
Abschlusstagung des Forschungsprojekts „Mobile Dinge, Menschen und Ideen. Eine bewegte Geschichte Niederösterreichs“
Mittwoch, 3. – Freitag, 5. November 2021
- 3./4.11.2021: FH St. Pölten, Campus-Platz 1, Mittlerer Festsaal, Eingang Gebäude B
Eintritt entsprechend der geltenden gesetzlichen COVID-Maßnahmen, Einlass ab 9.15
- 3.11.2021: 18.30: Haus der Geschichte im Museum NÖ, Kulturbezirk
Eintritt entsprechend der geltenden gesetzlichen COVID-Maßnahmen
- 5. 11. 2021: 8.30-18.30: MAMUZ Schloss Asparn/Zaya und Museumsdorf Niedersulz
Eintritt entsprechend der geltenden gesetzlichen COVID-Maßnahmen
Verpflichtende Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at|
Programm
mehr...
Mittwoch, 3. 11. 2021
10.00-10.30
Grußworte
Hermann Dikowitsch (Leiter der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ)
Hannes Raffaseder (Geschäftsführung FH St- Pölten| Chief Research and Innovation Officer)
Martha Keil (Projektleitung)
10.30-11.15
Keynote
Klara Löffler (Wien): Ins Verhältnis gesetzt: Mobilitäten und Dinge
11.15-11.45
Franz Pieler (Asparn/Zaya): Erfindung der Sesshaftigkeit? Die „neue Mobilität“ in der Jungsteinzeit
11.45-12.30
Daniela Fehlmann, Julia Längauer (Krems): Mobilität und Handel – eine bewegte Geschichte Niederösterreichs am Beispiel der linearbandkeramischen Zentralsiedlung von Asparn/Schletz
14.00-14.45
Christina Antenhofer (Salzburg): Menschen, Objekte und Räume in Bewegung: Die Mobilität der Dinge am Beispiel spätmittelalterlicher Inventare
14.45-15.30
Karin Kühtreiber, Thomas Kühtreiber, Regine Puchinger (Salzburg, Krems): Woher, wohin und warum? Religiöse ‚Wearables‘ als materielle Zeugen frühneuzeitlicher Mobilität
16.00-16.30
Annina Forster, Ulrike Vitovec (St. Pölten): Was real übrig blieb. Kleidungsbestände aus dem Wald- und Weinviertel in den Sammlungen von Museen
16.30-17.15
Reinhard Bodner (St. Pölten): Mobilisiertes Wissen. Ein Trachtenfragebogen für den Atlas der Deutschen Volkskunde
18.30
Round Table „Mobilität sammeln?“ (Haus der Geschichte im Museum NÖ)
Hanno Loewy (Hohenems), Andreas Liska-Birk, Christian Rapp, Ulrike Vitovec (St. Pölten), Regina Wonisch (Wien) – Moderation: Sandra Sam (Krems)
Donnerstag, 4. 11. 2021
10.00-10.45
Felicitas Heimann-Jelinek (Wien): Das Ding an sich. Oder wie Objekte Erinnerung dynamisieren können
10.45-11.30
Philipp Mettauer (St. Pölten): Der verschwundene Steyr XX und Schneeschuhe in Palästina. „Arisierte“ Dinge und Dinge des Exils
11.30-12.15
Merle Bieber (St. Pölten): „My Dirndl is over the ocean“: Die Bedeutung von Tracht für österreichische Jüdinnen und Juden nach der Shoah
12.15-13.00
Elke-Vera Kotowski (Berlin): Berlin – Montevideo und ditigal retour. Formen der Transformation von jüdischem Kulturerbe
14.30-15.10
Dieter Bacher, Richard Wallenstorfer (Graz), Anne Unterwurzacher (St. Pölten): „Sonntagswagen und Pflug“ – mitgebrachte und verlorene Dinge im Kontext der Zwangsmigration deutscher Minderheiten (1944-1946)
15.10-16.00
Veronika Reidinger, Barbara Stefan (St. Pölten): (Nicht) im Gepäck? Vom Flüchten und Ankommen rund um das Jahr 2015
16.30-17.15
Friedemann Yi-Neumann (Göttingen): Dinge – Fluchtmigration – Museum. Zu Möglichkeiten und Dilemmata einer materiell-reflexiven Migrationsforschung
17.15-18.00
Birgit Johler (Graz): In Bewegung: Objekte und Sammlungen, Themen und Präsentationsweisen. Das neue Volkskundemuseum in Graz
18.00-18.10
Martha Keil (Wien/St. Pölten): Verabschiedung
Freitag, 5. 11. 2021
Exkursion
Verpflichtende Anmeldung: |mail: office@injoest.ac.at|
- 08.30: Abfahrt Bahnhof St. Pölten (Rückseite)
- 10.00-12.00: MAMUZ Schloss Asparn/Zaya
- 12.15-13.30: Mittagessen im Gasthaus Niedersulz
- 14.00-15.30: Museumsdorf Niedersulz
- 15.30-16.00 Kaffeepause
- 16.00-17.00: Textildepot
- Ca. 18.30: Ankunft Bahnhof St. Pölten
Kosten: € 35,- (zu zahlen beim Tagungsbüro am 3./4. 11. 2021). Inkludiert Museumseintritte mit Führungen sowie die Busfahrt.Mittagessen (Menü € 11,90) sowie die Kaffeepause sind selbst zu bezahlen.
|Hier finden Sie das Programm zum Download|.
|Informationen zum Projekt finden Sie hier.|
...weniger

Der Gürtel des Walter Fantl
Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ in memoriam Walter Fantl-Brumlik
Freitag, 22. Oktober 2021, 18:30
Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten und via Livestream
mit Gerhard Zeillinger (Historiker, Biograf)
Martha Keil (Direktorin INJOEST)
Nina Moldauer und Karin Rivollet (Nichten von Walter Fantl-Brumlik)
Eintritt oder Streaming-Ticket: EUR 3,50 pro Person, kostenlos mit der Museum Niederösterreich Jahreskarte
Online-Tickets: |www.museumnoe.at/erzaehltegeschichte
Ticket-Reservierung: |mail: anmeldung@museumnoe.at|
Walter Fantl-Brumlik, geboren am 6. März 1924, wuchs in Bischofstetten (NÖ) als Sohn eines jüdischen Gemischtwarenhändlers auf. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich 1938 wurde das Geschäft der Eltern „arisiert“, die Familie musste in eine Sammelwohnung nach Wien ziehen und wurde im Oktober 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert.
mehr...
Im September 1944 wurde Walter Fantl-Brumlik ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überstellt. Dort blieb ein Ledergürtel sein einziger persönlicher Besitz, den er fortan als Talisman verstand. Tatsächlich überlebte Walter Fantl-Brumlik, seine Eltern und seine Schwester fielen dem Holocaust zum Opfer.
Im Frühjahr 2020 erhielten die Landessammlungen Niederösterreich den Nachlass von Walter Fantl-Brumlik. Ab Herbst 2021 werden ausgewählte Objekte des Nachlasses, darunter der Gürtel, im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich ausgestellt.
Der Historiker Gerhard Zeillinger veröffentlichte unter dem Titel „Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl“ die Biografie von Walter Fantl-Brumlik, die 2018 erschienen ist. Er war ein langjähriger Wegbegleiter des am 24. Oktober 2019 in Wien verstorbenen KZ-Überlebenden. Gemeinsam mit Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, spricht Gerhard Zeillinger mit Moderator Reinhard Linke über das tragische Schicksal des unermüdlichen Zeitzeugen. Seine Nichten Nina Moldauer und Karin Rivollet werden anwesend sein.
...weniger
Die „Heil- und Pflegeanstalt” Mauer-Öhling in der NS-Zeit
21. Oktober 2021, 19:30
Volkshochschule Waidhofen an der Ybbs, Plenkersaal
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer. Alle weiteren Informationen finden Sie |hier|!
Lange Nacht der Museen
2. 10. 2021, ab 18 Uhr
Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
Es gilt die 3G-Regel!
Das beeindruckende Jugendstilgebäude mit seinen prächtigen Wandmalereien wurde 1913 eingeweiht, 1938 schwer beschädigt und nach der Renovierung 1984 wiedereröffnet. Da die jüdische Gemeinde St. Pöltens vernichtet wurde, dient die Synagoge nun als Lern- und Gedenkort. Seit 1988 beherbergt sie das Institut für jüdische Geschichte Österreichs. Die wenigen erhaltenen Objekte sowie die Ausstellung „Es gab so nette Leute dort… Die zerstörte jüdische Gemeinde St. Pölten" auf der Frauengalerie vermitteln das Schicksal der jüdischen Gemeinde.

Programm
18.00–18.30 Vortrag
Herbert Peter, Rita Lochner: Fundamente unterm Gehsteig? Die Rekonstruktion der ersten St. Pöltner Synagoge von 1885
19:00-19:30 Vortrag
Eveline Brugger, Birgit Wiedl: „...dass vor uns gewesen ist Abraham der Jude von St. Pölten“. Jüdisches Leben im mittelalterlichen Niederösterreich
20.00–21.30 Konzert
Scheiny’s All Star Yiddish Revue
Der beseelte, freche Swing authentisch jüdischer Musik: „Scheiny’s All Star Yiddish Revue”, ein unterhaltsames Repertoire aus traditionellen jiddischen Liedern, einer Prise Klezmer, jiddischem Swing aus den 1930ern bis den 60ern und Shtikeln aus der berühmten Musik- und Comedy-Tradition der Catskills, der „jüdischen Alpen”. „Scheinys” fährt auf eine Achterbahnfahrt zwischen Wehmut und augenzwinkernder Ironie.
Line up: Deborah „Scheiny“ Gzesh – Gesang, Martin Zrost – Saxophon, Muamer Budimlić – Akkordeon, W.V. Wizlsperger – Kontrabass, Paul Skrepek - Schlagzeug
Führung auf Nachfrage
Martha Keil, Christoph Lind: Die Ehemalige Synagoge und ihre Gemeinde
Museum des Augenblicks: Aus dem Mittelalter
Buffet mit kulinarischen Köstlichkeiten von Lorenz famos Delikatessen!
Eingang barrierefrei, jedoch nicht die WCs!
Nicht nur für Kinder: Mach Deinen eigenen Synagogen-Button!

OrtsWechsel
Samstag, 24. Juli 2021
13.00 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Melk (Südseite, Park & Ride-Parkplatz)
Christina Kandler (ZHZ Melk) führt zur örtlichen KZ-Gedenkstätte und spricht über „Die jüdisch kategorisierten KZ-Häftlinge von Melk.“ Achtung – längerer Fußmarsch ohne Sitzgelegenheit!
Im Anschluss: SELBSTSTÄNDIGE Fahrt nach St. Pölten (z. B. per Bahn um 15.38 Uhr).
16.00: Treffpunkt Bahnhof St. Pölten (Eingang Bahnhofplatz)
Spaziergang mit Christoph Lind (INJOEST) zur Ehemaligen Synagoge mit kurzen Zwischenstationen an ausgewählten „Steinen der Erinnerung“. Führung durch das Haus zum Thema „Geschichte – Gedenken – Gegenwart“.
Eine Anmeldung unter |mail: info@melk-memorial.org| oder per Telefon unter 0677/63658882 ist verpflichtend!
Die Teilnehmer:innenzahl ist aus praktischen Gründen auf 25 Personen beschränkt.
Es gilt die 3G-Regel!
OrtsWechsel – eine Kooperation des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) und dem Verein MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk (ZHZ).
Weitere Informationen
mehr...
Die Orte und Landschaften in denen wir leben, sind durch eine vielfältige gemeinsame Geschichte verbunden. Diese ist in Ruinen, Baudenkmälern und Erinnerungszeichen, in Akten, Dokumenten und alten Zeitungen, in Büchern, Bildern, Fotos und Filmen festgehalten. Mancherorts gibt es auch noch die lebendigen Erinnerungen von Menschen, die diese Geschichte miterlebt haben. Die historischen Verbindungen in den Landschaften und Orten sind nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, können aber zum Sprechen und Erzählen gebracht werden. Dem dient der OrtsWechsel, bei dem wir diesen Verbindungen nachspüren wollen.
Der nächste OrtsWechsel findet erneut in Melk und St. Pölten statt (wir wiederholen den ersten Termin vom Oktober 2020, da damals die Teilnehmer:innenzahl auf Grund der Covid-19 Situation stark beschränkt war). Er verbindet zwei zentrale niederösterreichische Orte, die an die NS-Zeit erinnern – in Melk die KZ-Gedenkstätte und in St. Pölten die ehemalige Synagoge.
...weniger
Antisemitismus als Code. Forschung – Prävention – Intervention
30. Internationale Sommerakademie
7. – 9. 7. 2021
Volkskundemuseum Wien
Laudongasse 15-19, 1080 Wien
Judenfeindliche Codes und Stereotype sind längst in das kollektive Gedächtnis eingegangen und erzeugen unbewusst Wiedererkennung, Vertrautheit und damit eine Bereitwilligkeit zur Rezeption bis hin zur Anerkennung der Faktizität. Diese Phänomene werden einerseits auf wissenschaftlicher Ebene vorgestellt und diskutiert, andererseits dienen sie als Ansatz für didaktische Programme in unterschiedlichen sozialen Gruppen, von Schulen über Jugendliche und junge Erwachsene bis hin zur Lehrer*innenfortbildung.Die Vortragenden dieser Sommerakademie erforschen einerseits Judenhass und Antisemitismus in Mittelalter und Gegenwart, andererseits arbeiten sie konkret an Maßnahmen zur Prävention und Intervention bei antisemitischen Haltungen und Handlungen.
Hier finden Sie unseren |Programmfolder|!

Kontinuität und Aktualität des Antisemitismus. Eine österreichische und globale Herausforderung
Zur Kontinuität des Antisemitismus. Von der Wiener Gesera 1421 bis zur Gegenwart
4. 3. 2021
16:00 – 18:00
Online Podiumsdiskussion inkl. Live-Stream in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung Die FURCHE (Teilnahme unter |https://youtu.be/VHq0T-Kiq10|)
Martha Keil hält den Impulsvortrag „Judenbilder“ und Stereotype – von der Wiener Gesera 1421 bis heute.
Programm
mehr...
Moderation: Assoz.Prof.in Regina Polak
Begrüßung
Dr. Hannes Swoboda, Vorstandsvorsitzender des Sir Peter Ustinov Instituts
30´ Impulsvortrag
„Judenbilder“ und Stereotype – von der Wiener Gesera 1421 bis heute
Dr.in Martha Keil, Institut für jüdische Geschichte in Österreich
90´ Panel
- Ergebnisse der Antisemitismusstudien 2018 für Österreich
Dr.in Eva Zeglovits, Geschäftsführerin IFES
- Christlich- jüdische Zusammenarbeit im Kampf gegen Antisemitismus
Dechant Ferenc Simon, Dechant und Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische
Zusammenarbeit
- Zeitgenössischer Antisemitismus und seine Erscheinungsformen
Ao. -Univ. Prof.in Dr. Helga Embacher, Institut für Zeitgeschichte, Universität Salzburg
- Antisemitismus und die neuesten Entwicklungen in Ungarn
Prof.in Dr.in Éva Kovács, Wissenschaftliche Leitung, Simon Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien
- Antisemitismus in Österreich und was dagegen unternommen werden kann
Rabbiner Jaron Engelmayer, Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
...weniger
VWI invites the Institut für jüdische Geschichte Österreichs
10. 12. 2020, 15 Uhr
Benjamin Grilj coments on Julie Dawson: „As to my emotional anguish, there are days when I feel endlessly miserable…”: Hachsharot in Early Post-War Romania and the Limits of Belonging
This online-presentation examines the activities of Zionist youth organisations in Romania during the immediate post-war period using documents created by the Securitate (secret police) and the organisations themselves.Then there will be a microhistorical approach to probe the experience of the participating individual through a set of recently found survivor diaries.
mehr...
The situation of Jews in postwar Romania was unlike any other in Europe. Approximately half of the Jewish population had survived the war: numbering between 350,000 and 400,000, this group was fundamentally diverse, not only in their pre-war background, linguistic, and cultural affiliations, but also, and of great significance, their war-time fate.Uniting many, if not most, however, was the powerful desire to leave Romania. An outlet for the energies and aspirations of frustrated young people was provided by numerous Zionist organisations active in every part of the country. These organisations, especially those of the HeHalutz movement, fomented for action, gearing their activities towards the practical and the immediate. Hachshara centres were established across the country and thousands of Jewish young people criss-crossed the land to live on communal collectives, training as farmers and factory workers, preparing for an uncertain Aliyah of dubious promise and dreaming of a new life. While working to reconstruct the impressive breadth of Zionist activity in the tumultuous post-war years, I also examine the limits of their propaganda and community-building work and their failure to address the psychological and physical needs of Holocaust survivors: despite apparent inclusion in a cohesive and sympathetic group, the author of the diary experiences alienation and marginalization within her own ranks.
Benjamin Grilj, Post-Doc at the Institute for Jewish History in Austria with a special focus on regional Holocaust-Studies, Migration-Studies, genealogic research, Digital Humanities, Eastern European History. Former lecturer at the University of Chernivci, research fellow at the Institute for Bukovina Studies and the Austrian Library Czernowitz. Editor of Black Milk. Withheld letters from the death camps of Transnistria (2013).
Julie Dawson is a doctoral candidate at the University of Vienna’s Institute for Contemporary History. She holds degrees from Columbia University and Northwestern University. Dawson worked for the Leo Baeck Institute from 2010 to 2019, directing their archival survey of Transylvania and Bukovina (jbat.lbi.org) from 2012 to 2019. From 2016 to 2019 she was researcher-in-residence in Mediaș (Romania) for the EU Horizon 2020 project TRACES: Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts. Her research interests include Bukovina, communist Romania, women’s history, trauma and memory studies.
...weniger
Koscher in Wien 1848 bis 1918. Produktion und Konsum
Ein Werkstattbericht von Christoph Lind im Rahmen des Rural History Forum 70
16.11.2020
14.00–15.30 Uhr
Online-Vortrag.
Das Judentum kennt mit der Kaschrut (wörtlich: rituelle Tauglichkeit), also der Gesamtheit der jüdischen Speisegesetze, die zudem eine Säule jüdisch-religiöser Identität darstellen, ein umfassendes Konzept der rituellen Reinheit in der Nahrungsaufnahme. Der von ihr vorgegebene Rahmen wird in der Diaspora in einem vorwiegend nichtjüdischen Umfeld gelebt, das den Großteil der Rohprodukte erst produzierte, und in dem sie dann, koscher gemacht, auch konsumiert wurden.
mehr...
Zu diesem Umfeld gehört auch die Stadt Wien, bis 1938 eine der größten jüdischen Gemeinden Europas. Die Bedingungen und Bedingtheiten koscheren Lebens in Wien von 1848 bis 1918 sind bis heute weitgehend unerforscht. Die vorliegenden Untersuchungen zum jüdischen Wien zielen vielfach auf Kultur, Kunst, Wissenschaft, Politik und den jüdischen Anteil oder Beitrag dazu, Fragen der „koscheren Infrastruktur“ werden meist beiläufig in diesen oder anderen Kontexten erwähnt, aber nicht systematisch erörtert.
...weniger
Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer
ABSAGE
Donnerstag, 12. November 2020, 19h30
Waidhofen/Ybbs, Gemeinderatssitzungssaal, Oberer Stadtplatz 28
Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling war die drittgrößte Klinik Österreichs, die im nationalsozialistischen System an der Ermordung von Psychiatrie-Patientinnen und -Patienten beteiligt war. Nach den „Todestransporten“ der Jahre 1940/41 bzw. 1943 nach Niedernhart, Hartheim und Gugging, bei denen insgesamt 1.600 Personen ums Leben kamen, wurde anstaltsintern weiter gemordet.
mehr...
Die Sterberate verdreifachte sich und die Todesfälle häuften sich dermaßen, dass der überfüllte Anstaltsfriedhof entlang der Straße Amstetten – Waidhofen erweitert werden musste. Kurz vor Kriegsende, im November 1944 und April 1945, kam es schließlich zu einer letzten Mordaktion durch Anstaltsärzte und Pflegepersonal, der nochmals rund 200 Menschen zum Opfer fielen.
Der Vortrag wird aktuelle Erkenntnisse aus neu ausgewerteten Archivbeständen, die im Rahmen langjähriger Forschungsprojekte am Institut für jüdische Geschichte Österreichs gewonnen wurden, präsentieren und diskutieren.
Eintritt: € 10,00
|Weitere Informationen|
...weniger

Gedenken an die Novemberpogrome 1938
9. November 2020
ABSAGE
18.30 Uhr, Ehemalige Synagoge
Briefe von St. Pöltner Opfern der Shoa
Beim Gedenkstein an der Außenmauer können Lichter (bitte ohne religiöse Symbole) entzündet werden.
19.00 Uhr, Bildungshaus St. Hippolyt
Gedenken braucht Forschung
Martha Keil: Neue Steine der Erinnerung in St. Pölten
Philipp Mettauer: Massengräber in Mauer-Öhling: 275 Ermordete und kein Gedenken
Anschließend, am Weg zum Rathausplatz, werden im Gedenken weiße Rosen und Grablichter bei den Steinen der Erinnerung platziert.
Namen, Gräber und Gedächtnis
Abschlussveranstaltung zum Top Citizen Science-Projekt zur „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit
ABSAGE
Die geplante Veranstaltung für den 4. November 2020, 19 Uhr, im MozArt Amstetten ist aufgrund der ab 3. 11. geltenden Bestimmungen abgesagt. Wir werden versuchen die Präsentation der Projektergebnisse online zugänglich zu machen.
Bisherige Veranstaltungen
mehr...

„OrtsWechsel”: St. Pölten/Melk
Sonntag, 25. Oktober 2020
13 – 18 Uhr
ab 13 Uhr: Ehemalige Synagoge St. Pölten (Dr.-Karl-Renner-Promenade 22)
„Geschichte - Gedenken - Gegenwart”
ab 15.30 Uhr: Treffpunkt Bahnhof Melk (Südseite, P&Ride-Parkplatz)
„Opfer - Täter - Gesellschaft: Biografien zum KZ-Außenlager Melk”
Maximal 12 Teilnehmer möglich, Anmeldung unter |mail: info@melk-memorial.org|
Eine Kooperation des Zeithistorischen Zentrums Melk und des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten.
Wir empfehlen für die Weiterfahrt von St. Pölten nach Melk bzw. retour die regelmäßig verkehrenden Zugverbindungen der ÖBB.
Wladigeroff Brothers feat.Benjy Fox Rosen
3. 10. 2020, 20 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
„Die Amsterdam Besetzung“. Eine musikalische Reise mit Klezmer, Swing, Balkan Jazz, eigener Musik und viel Lachen
- Alexander Wladigeroff - Trompete & Flügelhorn
- Konstantin Wladigeroff - Klavier & Klarinette
- Benjy Fox Rosen - Kontrabass & Gesang

Sakrale Bauten profan genutzt?
21. 9. 2020, 16:15 – 17:00 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Führung mit Martha Keil durch die Ehemalige Synagoge St. Pölten
Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei, Anmeldung erbeten unter: |mail: office@orte-noe.at|
mehr...
Beim Architekturwettbewerb zum Sakralbau setzte sich der Entwurf von Theodor Schreier, der bereits Synagogen in Skotschau und Ustron in Österreich-Schlesien realisiert hatte, durch. Die Bauleitung des Projekts, dessen Errichtungskosten 141.000 Kronen betrugen, übernahm Viktor Postelberg.Die Reichspogromnacht setzte 1938 nach der kurzen Nutzungsdauer eines Vierteljahrhunderts dem St. Pöltener Haus der jüdischen Gemeinschaft ein radikales Ende. Das Innere wurde demoliert, das Gebäude selbst überdauerte. Bei den Kampfhandlungen zu Kriegsende jedoch wurde der Zentralbau am Dachstuhl, bei der Eindeckung und an der Fassade beschädigt. Diese doch sehr massiven Schäden hatten 1979 einen Antrag auf Abbruch durch die Israelitische Kultusgemeinde Wien zur Folge, dem jedoch nicht stattgegeben wurde. Stattdessen wurde eine Instandsetzung organisiert: Ein Kuratorium beschloss weiterführend die Umwandlung der Synagoge in ein Kulturzentrum. Im Kantorhaus, das ehemals die Wohnungen für Kantor und Tempeldiener sowie einen Schul- und einen Versammlungsraum beherbergte, wurde das „Institut für jüdische Geschichte Österreichs“ installiert. Eine Dauerausstellung im Synagogenraum dokumentiert das jüdische Leben in der Landeshauptstadt.
(Text: Theresia Hauenfels, erschienen in: Architekturlandschaft Niederösterreich, 1848 bis 1918, Hg. Kunstbank Ferrum – Kulturwerkstätte und ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich, Verlag Park Books)
...weniger

17:00 – 19:00 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Vorträge und Diskussion
mehr...
- Begrüßung: Martha Keil - Ehemalige Synagoge St. Pölten, Heidrun Schlögl - ORTE-Geschäftsführerin, Krems
- Einführung: Maria Welzig - Architekturhistorikerin, Wien
- Impulsvorträge und Podiumsdiskussion
Amanda Augustin - Kulturverein Raumteiler, Veranstalterin von „Holy Hydra“, Linz
Ernst Beneder - Architekt, Wien
Jörg Beste - Architekt, Stadtplaner – synergon, Köln
Harald Gnilsen - Architekt, Baudirektor der Erzdiözese Wien
Martha Keil - Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Wien / Universität Wien, Institut für österreichische Geschichtsforschung
Moderation: Maria Welzig
- Anschließend Diskussion mit dem Publikum.
20:00 Uhr, Cinema Paradiso, St. Pölten:
|Architektur der Unendlichkeit|
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der gesamten Veranstaltung Fotos gemacht und zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Dokumentation verwendet werden.
...weniger

„Menschenbilder“ mit Irene Schreier
Am 20. 9. 2020, um 14.00 sprach Johann Kneihs in der Reihe „Menschenbilder“ in Ö1 mit Irene Schreier (geb. 1929), der Enkelin des Architekten der St. Pöltner Synagoge, Theodor Schreier.
Zur Enthüllung seiner Gedenktafel am Eingang der Ehem. Synagoge am 3. 10. 2019 gab sie mit ihrer Tochter und Enkelin ein unvergessliches Konzert.

„Mauer des Schweigens“. Eine Anstalt im kollektiven Gedächtnis
Online-Präsentation des Dokumentarfilms
19.–25. Mai 2020
im Programm „Kino on demand“ auf PerspektiveKino.at
Etwa 2800 Patientinnen und Patienten wurden in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling – heute das Landesklinikum Mauer – in der NS-Zeit ermordet, zu Tode gebracht oder zur Vernichtung nach Hartheim und Gugging deportiert. Im Dokumentarfilm „Mauer des Schweigens“ interviewten neun Schüler*innen der ALW Amstetten Angehörige von Opfern und Tätern der NS-Morde sowie Menschen, die vom Umgang mit den Ereignissen nach 1945 erzählten. Der von den Schüler*innen in Eigenregie gedrehte Film entstand im Rahmen des Sparkling-Science-Projekts „,Geschlossene‘ Anstalt? Die ,Heil- und Pflegeanstalt‘ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis“ des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten) und der ALW Amstetten, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Amstetten und dem NÖ Landesarchiv. In dem zweijährigen Forschungsprozess setzten sich die Schüler*innen auch mit der Erinnerung an die Opfer vor Ort auseinander. Dieses filmische Zeugnis soll zur schrittweisen Bewusstwerdung beitragen und der Erinnerung an die Opfer in Mauer-Öhling dienen.
mehr...
Der Film entstand mit Unterstützung des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, der Direktion der ALW Amstetten und der Stadtgemeinde Amstetten.
Die Projektbroschüre „,Geschlossene‘ Anstalt? Die ,Heil- und Pflegeanstalt‘ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis“ (PDF) finden Sie |hier|.
Zum Programm „Kino on demand“ des Perspektive Kino Amstetten:
|www.perspektivekino.at|
|www.instagram.com/perspektivekinoamstetten|
|www.facebook.com/PerspektiveKino|
...weniger




Die Utopie des „gesunden Volkskörpers”
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1, 1020 Wien
Folgende Vorträge haben stattfgefunden:
Do, 27.02.2020, 18:30-20:00
Philipp Mettauer, Ärzte und andere Täter. Mauer-Öhling im Nationalsozialismus
Do, 05.03.2020, 18:30-20:00
Christoph Lind, Psychiatrie im Wiener Rothschild-Spital (1873-1945)
Abgesagt werden mussten die folgenden Vorträge:
Do, 19.03.2020, 18:30-20:00
Claudia Spring, Erbitterter Widerstand gegen die Zwangsterilisation: Elisabeth S. und ihre Erfahrungen mit der NS-Bürokratie
Do, 26.03.2020, 18:30-20:00
Hemma Mayrhofer, Zwischen umfassender Deprivation und liebevoller Verwahrung: Kinder mit Behinderungen in der Wiener Psychiatrie nach 1945
Do, 02.04.2020, 18:30-20:00
Winfried R. Garscha, Gescheiterte Gerechtigkeit? Die strafrechtliche Ahndung der NS-Medizinverbrechen
„Auschwitz ist uns anvertraut“
Mit langem kräftigen Applaus wurde bei der offiziellen Gedenkfeier der Republik Österreich am 27. Jänner 2020 Martha Keils Rede „Auschwitz ist uns anvertraut“ – Gedanken zu „Befreiung“ und „Vermittlung“ bedacht.
Weitere Informationen finden Sie |hier|!
Holocaust-Gedenktag
Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner 2020 wollen wir uns an jene jüdischen St. Pöltnerinnen und St. Pöltner erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Wir laden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu ein, die in der Stadt verlegten Steine der Erinnerung zu reinigen und in individuellem Gedenken weiße Rosen niederzulegen oder Kerzen (bitte ohne christliche Symbolik) aufzustellen.
Die einzelnen Standorte finden sich unter diesem Link: |Steine der Erinnerung in St. Pölten|
Möge das Andenken der Ermordeten zum Segen sein.
mehr...
Gedenken und Forschen
Zum Jahrestag der Novemberpogrome
In den ersten Novembertagen gedenken wir der Gewaltereignisse der Reichspogrome und der Opfer der Judenvernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus.
12. November 2019
18:30 Uhr Ehemalige Synagoge St. Pölten
Gedenken an die vernichtete jüdische Gemeinde St. Pölten; beim Gedenkstein an der Außenmauer können Lichter (bitte ohne religiöse Symbole) entzündet werden.
Weg im Schweigen zum Bildungshaus St. Hippolyt
19.00 Uhr Bildungshaus St. Hippolyt
Gedenken braucht Forschung
Das Team des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs gibt Einblicke in aktuelle Forschungen zum Nationalsozialismus.
Moderation: Dr. Martha Keil
Anmeldung bis Mo. 04.11.2019 unter |mail: office@injoest.ac.at|
In Kooperation mit dem Bildungshaus St. Hippolyt und dem Diözesankomitee Weltreligionen St. Pölten.
Bewegte Landbilder
Symposium zur Erschließung der Filmsammlung „Niederösterreich privat“
30. Oktober 2019, 17.00–19.00 Uhr
31. Oktober 2019, 10.00–16.45 Uhr
Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
Sankt Pölten, Kulturbezirk 5
Nach dem äußerst erfolgreichen Aufruf zur Einbringung von Schmalfilmen, den das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem Filmarchiv Austria 2013 initiierte, ist „Niederösterreich privat“, eine der weltweit größten Amateurfilmsammlungen, entstanden. Im vergangenen Jahr hat ein Team des niederösterreichischen Forschungsnetzwerks Interdisziplinäre Regionalstudien (first) unter Beteiligung des Injoest im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur damit begonnen, diese wertvolle Sammlung systematisch zu erschließen. Im Rahmen des Symposiums werden erste Ergebnisse dieses Projekts präsentiert und mit internationalen Expertinnen
und Experten diskutiert.
|Programm|
mehr...
Informationen zum Programm auf |www.ruralhistory.at|
Veranstalter: Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first) in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria und dem Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
Organisation: Johanna Zechner (Projektkoordination), Brigitte Semanek, Ulrich Schwarz-Gräber (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes)
...weniger
Lange Nacht der Museen
5. Oktober 2019, 18:00 – 01:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Programm
18.30–19.00 Vortrag
Kriegsende 1918 – Chaos mit Neubeginn?
Christoph Lind
20.00–21.30 Konzert
„Alois“ – Mit Liedern, Chansons, Tangos und Operettenwalzern entführen Ethel Merhaut und Das Trio (Klavier, Trompete, Kontrabass) in die Welt der verlorenen Film- und Unterhaltungsmusik der 1920er- und 30er Jahre.
22.00–22.45 Führung
Die Ehemalige Synagoge und ihre Gemeinde
Martha Keil
Museum des Augenblicks
Eine ganz normale Urkunde aus dem 14. Jahrhundert
Nicht nur für Kinder: Mach einen Button mit deinem hebräischen Namen!
Anmerkung: Eingang barrierefrei, jedoch nicht die WCs!
Allgemeine Informationen zur Langen Nacht der Museen finden Sie |hier|!


Gedenkkonzert für Theodor Schreier
Donnerstag, 3. Oktober 2019
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Theodor Schreier war einer der Architekten für die St. Pöltner Synagoge. Anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel für ihn und seine Frau Anna – beide sind in Theresienstadt umgekommen – spielt seine Enkelin, die Pianistin Irene Schreier Scott (USA) mit ihrer Tochter Monica (Cello) und ihrer Enkelin Magali (Violine) Bloch, Janacek, Brahms, Schulhoff und Dvorak.
17:30: Enthüllung der Tafel
18:30: Konzert
Eintritt: freie Spende
Forschungsfest Niederösterreich
Am 27. September 2019 findet im Palais Niederösterreich in Wien das Forschungsfest Niederösterreich statt.
Von 14 bis 22 Uhr können Interessierte bei freiem Eintritt in Kontakt mit Wissenschaft und Forschung treten.
Auch wir sind mit einem Stand vertreten.
|Information|

Erzählte Geschichte mit Hans Morgenstern
Hans Morgenstern im Gespräch mit Martha Keil und Reinhard Linke
24. September 2019, 18:00
Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 Sankt Pölten
mehr...
Zeitzeugen-Forum mit Hans Morgenstern
Bis zum Jahr 1938 lebten über 1.000 Jüdinnen und Juden in St. Pölten. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde im Holocaust ermordet. Den Eltern von Hans Morgenstern gelang es, mit ihrem 15 Monate alten Sohn und Teilen der Familie 1939 nach Palästina zu flüchten. 1947 kehrten sie nach Österreich zurück. Heute ist er der letzte jüdische Bewohner St. Pöltens.
Im Gespräch mit Martha Keil, Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (INJOEST) und Reinhard Linke (ORF NÖ) erzählte Hans Morgenstern von seiner Kindheit, der schwierigen Rückkehr in das Nachkriegsösterreich und von seinen Sorgen über die gegenwärtige politische Kultur im Land.
EIne Nachschau zur Veranstaltung finden Sie |hier|!
...weniger
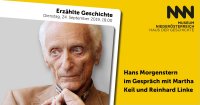
Migration findet Stadt II
Mit Christoph Lind auf den Spuren des jüdischen St. Pölten
23. September 2019, 17 Uhr
Treffpunkt: Ehemalige Synagoge, Dr. Karl-Renner-Promenade 22
Dauer: 2 Stunden
Das jüdische St. Pölten entstand nach 1848 durch Zuwanderung von Juden und Jüdinnen vor allem aus Böhmen und Mähren. Ein erstes Bethaus wurde bereits in den 1850er Jahren eingerichtet, 1913 der bis heute erhaltene Prachtbau eingeweiht. St. Pölten war das Zentrum des jüdischen Lebens zwischen Wien und den Voralpen. 1938 lebten in der Stadt rund 400 Juden/Jüdinnen. Wem nach dem „Anschluss" die Flucht nicht gelang wurde von den Nazis ermordet. Nach 1945 kehrten nur mehr einige wenige nach St. Pölten zurück. Gemeinsam mit Christoph Lind begeben wir uns auf eine Spurensuche zu den Orten der einst blühenden jüdischen Gemeinde.
Informationen zu weiteren Stadtspaziergängen finden Sie |hier|!
Mazel tov!
Konzert
Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, Roman Grinberg & Klezmer Swingtett
18.09.2019, 19:30 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
Klezmer Swingtett: Aliosha Biz – Violine / Sasha Danilov – Klarinette / Igor Pilyavskiy – Akkordeon / Peter Strutzenberger – Bass / Wolfgang Dorer – Drums / Roman Grinberg – Piano
Namen, Gräber und Gedächtnis
Eröffnungsveranstaltung
10. September 2019, 19 Uhr
Rathaussaal der Stadt Amstetten
Programm
Begrüßung
Vertretung der Stadt Amstetten
Martha Keil (Injoest)
Prim. Christian Korbel (Landesklinikum Mauer)
Informationen zum Projekt
Philipp Mettauer: Namen, Gräber und Gedächtnis. Der Anstaltsfriedhof Mauer-Öhling
Wolfgang Gasser: Projektablauf und Informationen zur Mitwirkung
Diskussion
Informationen zum Projekt finden Sie |hier|!

Gesangsworkshop und Konzert
mit Roman Grinberg
Donnerstag, 15.08.2019 – Sonntag, 18.08.2019
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Auch im Sommer 2019 leitet Roman Grinberg wieder einen Gesangs-Workshop in der Synagoge St. Pölten. Am Programm stehen dieses Mal Melodien aus den beliebtesten jüdischen Musicals wie „Anatevka“ oder „Mamele“ sowie Lieder jüdischer Volkspoeten (z.B. „Yidl mit’m Fidl“ von Itzik Manger oder „Kinder-Yorn“ von Mordechai Gebirtig).
|Weitere Informationen |zu Ablauf und Anmeldung
Abschlusskonzert
Sonntag, 18.08.2019, 18:00
Das Konzert ist die Abschlußveranstaltung des 4-tägigen Workshops. Dabei werden die TeilnehmerInnen das Erlernte einem breiten Publikum präsentieren.
Eintritt frei.
mehr...
Roman Grinberg ist Sänger, Pianist, Komponist und Arrangeur. Seit 2002 leitet er den Wiener Jüdischen Chor, seit 2013 ist er Intendant des European Jewish Choral Festival, seit 2014 künstlerischer Leiter des Festivals „Wien – Tel Aviv“ und seit 2017 Intendant des Yiddish Culture Festivals. Im kleinen Schtetl Belz in Moldawien mit Jiddisch als Muttersprache aufgewachsen, ist er heute gefragter Seminarleiter und erfahrener Vocal-Coach. In der internationalen Klezmer-Festivalszene gilt er als Experte für alte und neue Jüdische Musik in all ihren Ausprägungen, ganz speziell in Verbindung mit Jazz.
Mit diesem Workshop-Angebot richten wir uns an Menschen, die sich für die jüdische Kultur im Allgemeinen und für Jiddische Lieder im Besonderen interessieren. An erster Stelle steht dabei der Spaß am Singen. Vier Tage intensives Singen erwarten die Teilnehmenden. Willkommen sind dazu AnfängerInnen ebenso wie Fortgeschrittene. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir erarbeiten gemeinsam neues Repertoire und üben stilsicher Jiddisch zu singen – in der Gruppe ebenso wie Solo. Jeden Tag singen wir von 10.00 bis 13.00 und von 15.00 bis 17.00 Uhr. Am Donnerstag, Freitag und Samstag finden abends Jam Sessions mit offener Bühne in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre statt. Die Teilnahme an diesen Sessions ist für alle WorkshopteilnehmerInnen freiwillig und kostenlos.
Am Sonntag findet unser gemeinsames Abschlusskonzert in der ehemaligen Synagoge St. Pölten statt, wo wir das Erlernte einem interessierten Publikum präsentieren. Begleitet werden die SängerInnen dabei von professionellen Musikern.
...weniger

Die Utopie des „gesunden Volkskörpers“. Von der „Erb- und Rassenhygiene“ zur NS-Euthanasie
29. Internationale Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs
Mi., 3. – Fr., 5. Juli 2019, Volkskundemuseum Wien
mehr...
|Programmfolder|
Bis zu 200.000 Menschen wurden im „Dritten Reich“ und den besetzten Gebieten in der NS-Euthanasie ermordet, 30.000 davon allein in der „Ostmark“. Opfer wurden sowohl Erwachsene als auch Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung, psychisch Kranke – zunächst während der so genannten „Aktion T4“ in zentral geplanten Deportationen in die Vernichtungsanstalten, später dezentral und anstaltsintern – KZ-Häftlinge im Zuge der „Sonderbehandlung 14f13“, nicht mehr arbeitsfähige Zwangsarbeiter/innen, sowie über diesen Personenkreis hinausgehend, Bewohner/innen von Pflege- und Altersheimen. Rund 400.000 als „erbkrank“ qualifizierte Männer und Frauen wurden zwangssterilisiert.
Die diesjährige Sommerakademie behandelt, beginnend mit der Wende zum 20. Jahrhundert, die Themenfelder der Eugenik und Zwangssterilisationen, die schließlich zum Massenmord an Psychiatrie-Patienten und -Patientinnen führten und behält dabei die Beziehungen zum Rassenwahn und dem Genozid an den europäischen Jüdinnen und Juden im Blick.
Aus dem aktuellen Forschungsprojekt des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs über die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit werden die neuesten Ergebnisse präsentiert. Der juristischen Ahndung der Medizinverbrechen, der Aufklärungsarbeit der Gedenkstätten und dem gesellschaftlichen – lange Zeit tabuisierten – Umgang von 1945 bis heute sind weitere Vorträge gewidmet.
...weniger
Zur Geschichte der Waldviertler Kultusgemeinden
Vortrag von Dr. Christoph Lind im Rahmen der Buchpräsentation „Jüdische Familien im Waldviertel und ihr Schicksal“ von Friedrich Polleroß
28. Mai 2019, 18 Uhr
Cafe Bookshop Singer am Rabensteig
Rabensteig 3, 1010 Wien
Jüdischer Friedhof St. Pölten
Kulturrundgang mit Dr. Martha Keil
23. Mai 2019, 18:00 - 19:00 Uhr
Eingang jüdischer Friedhof, Karlstettner Straße 3
Herren mit Kopfbedeckung
Der Rundgang gibt Einblick in jüdische Toten- u. Trauerbräuche und vermittelt die Geschichte und Vernichtung der einst blühenden Kultusgemeinde St.Pölten.

Lomir singen! Lasst uns singen!
Offener Vocalworkshop mit Roman Grinberg
Mittwoch, 15. Mai 2019, 18.00 - 20.00 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten, Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
Gesungen werden Jiddische Volkslieder, im historischen Ambiente der Ehemaligen Synagoge St. Pölten.
Vorkenntnisse sind nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.
mehr...
Roman Grinberg ist Sänger, Pianist und Komponist und leitet seit 2002 den Wiener Jüdischen Chor. Er ist
seit 2013 Intendant des European Jewish Choral Festival, seit 2014 künstlerischer Leiter des Festivals
„Wien – Tel Aviv“ und seit 2017 Intendant des Yiddish Culture Festival. Bei all dem bleibt ihm auch noch
Zeit, als „Russian Gentleman“ mit dem Russian Gentlemen Club den Bär steppen zu lassen.
Für Interessierte ab 15 Jahren, die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung erbeten, weitere Informationen erhalten Sie bei Marlies Eder via oder unter 0664 / 60499841.
Eine Kooperation des Festspielhaus St. Pölten, der Bühne im Hof, des Institut für jüdische Geschichte Österreichs
und des Büro für Diversität St. Pölten.
...weniger

„Geschlossene“ Anstalt? Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis
Abschlusspräsentation des Sparkling-Science-Projekts
Mittwoch, 8. Mai 2019
10:00 – 12:30
Landesklinikum Mauer, Festsaal
Hausmeninger Straße 221, 3362 Mauer
10:00 – 10:30: Grußworte
10:30 – 11:00: Einführung in die Thematik und Präsentation der Schüler/innen-Zeitschrift
11:00 – 12:30: Ergebnisse
14:00 Enthüllung
|Programm Vormittag| – |Programm Nachmittag|
mehr...
10:00 – 10:30: Grußworte
- Martha Keil (Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs)
- Eva Berger-Singer (Vertreterin des BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung)
- Roman Zehetmayer (Direktor des Niederösterreichischen Landesarchivs)
- Ursula Puchebner (Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Amstetten)
- Leopold Dirnberger (Direktor der Fachschule Amstetten)
10:30 – 11:00: Einführung in die Thematik und Präsentation der Schüler/innen-Zeitschrift
- Tina Frischmann, Wolfgang Gasser, Philipp Mettauer (Projektteam Injoest)
- Schüler/innen der Fachschule Amstetten
11:00 – 12:30: Ergebnisse
- Präsentation des von Schüler/innen gedrehten Films
- Dialogforum 1: Lebensgeschichten und Interviews
- Dialogforum 2: Erzählungen nach 1945
Imbiss zur Verfügung gestellt vom Landesklinikum Mauer.
14:00 Enthüllung
- eines Mahnmals für die Opfer der NS-Euthanasie von Mauer-Öhling
Um Ihre Anmeldung bis 30.4.2019 unter 07475/9004-12001 oder office@mauer.lknoe.at wird gebeten.
...weniger

Jüdische Armut und Wohltätigkeit
Vortragsreihe am Institut für jüdische Erwachsenenbildung
jeweils 18:30 – 20:00 Uhr
Jüd. Institut f. Erwachsenenbildung, Praterstern 1, 1020 Wien
14.3.2019
Wolfgang Gasser
Jüdisches Dienstpersonal in den Wiener Familienlisten (1792-1847)
21.3.2019
Benjamin Grilj
Jüdische Sozialvereine in Czernowitz (ca. 1845-1940)
28.3.2019
Christoph Lind
Arm und Koscher in Wien vor dem Ersten Weltkrieg
4.4.2019
Philipp Mettauer
„Für ein paar Pesos.“ Strategien des ökonomischen Überlebens im argentinischen Exil
11.4.2019
Martha Keil
Armut und Wohltätigkeit im mittelalterlichen Aschkenas
Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs / Reform und Orthodoxie in den jüdischen Gemeinden des ländlichen Niederösterreichs
Vortrag von Dr. Christoph Lind und Philipp Mettauer
im Rahmen des |Limmud Festival 2019|
Sonntag, 10. 3. 2019, 12:35 − 13:25
VHS Urania, Uraniastr. 1, 1010 Wien
Philipp Mettauer gibt einen Überblick über die Geschichte und die Tätigkeit des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs. Daran anknüpfend erzählt Christoph Lind über ein Forschungsthema: das Verhältnis zwischen Reform und Orthodoxie in den jüdischen Gemeinden des ländlichen Niederösterreichs. Die ersten beiden Gemeinden Niederösterreichs in Krems und St. Pölten (nach 1670) wurden in den 1850er Jahren als reformierte Gemeinden von Zuwanderern aus Böhmen und Mähren gegründet, die dem „Wiener Minhag“ folgten. In anderen Regionen stammten viele der Zuwanderer auch aus konservativen Gemeinden des heutigen Burgenlandes. Heftige Konflikte zwischen den Angehörigen der unterschiedlichen Strömungen blieben nicht aus. Der Vortrag folgt der Geschichte von Reform und Orthodoxie in den 15 niederösterreichischen Kultusgemeinden von der Zeit ihrer Entstehung nach 1850 bis zum Jahr 1938.
Juden und Krieg in der Frühen Neuzeit: Akteure, Erfahrungen, Strukturwandel
14.–15. Februar 2019
Universität Wien, Elise-Richter-Saal
Universitätsring 1, 1010 Wien
Die Frühe Neuzeit war eine Epoche intensivierter Kriegführung. Auch auf das jüdische Leben in der Frühen Neuzeit wirkten sich Kriege massiv aus: Als Spione, Soldaten oder Kriegslieferanten nahmen Juden direkt an kriegerischen Auseinandersetzungen teil; sie reflektierten über kriegerische Ereignisse und deren Folgen für Gemeinde und Familie; durch den Steuerdruck, Pogrome im Rahmen von Kriegshandlungen oder durch den Vorwurf der Konspiration mit dem Feind wurden jüdische Gemeinden zu Opfern von Gewalt.
Die internationale Tagung „Juden und Krieg in der Frühen Neuzeit“ greift ein zentrales Thema vormoderner jüdischer Geschichte auf. Multiperspektivisch wird die durch Kriege mittel- oder unmittelbar ausgelöste Transformation jüdischen Lebens in Mitteleuropa untersucht.
Programm
mehr...
|Programmfolder|
Donnerstag, 14. 2. 2019
9:00–9:15: Begrüßung
Thomas Winkelbauer (Direktor des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Wien), Sabine Ullmann (Vorsitzende der Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden e.V., Eichstätt): Begrüßung
9:15–9:30:Peter Rauscher (Wien)
Einführung in das Tagungsthema: Juden und Krieg in der Frühen Neuzeit
9:30–10:15: Reinhard Buchberger (Wien)
„... unter die soldaten gekommen“. Jüdische Soldaten in der kaiserlichen Armee
10:15–11:00: Marie Buňatová (Prag)
Der Handel der böhmischen Juden in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs
11:30–12:15: Michaela Schmölz-Häberlein (Bamberg)
Die Rolle jüdischer Heereslieferanten im Pfälzischen und Spanischen Erbfolgekrieg: Der Fall Zacharias Fränkel & Erben
12:15–13:00: Martin Schröder (Essen)
Jüdische Kriegslieferanten und Finanziers im „Großen Türkenkrieg“: Das Beispiel Braunschweig-Calenberg im Jahr 1685
14:30–15:15: Stefan Rohrbacher (Düsseldorf)
„...durchaus nichts von besonderen Leiden des jüdischen Stammes...“. Krieg und Kriegsfolgen im süddeutschen Raum (17./18. Jahrhundert)
15:15–16:00: Barbara Staudinger (Augsburg)
Jüdische Perspektiven auf den Dreißigjährigen Krieg
16:30–17:15: Christoph Augustynowicz (Wien)
Die Chmielnicki-Aufstände und ihre Auswirkungen auf das jüdische Gemeindeleben in Polen-Litauen
17:15–18:00: András Oross (Wien)
Im Schatten Oppenheimers: Die Juden in den ungarischen Neoacquistica nach der Türkenzeit
Freitag, 15. 2. 2019
9:30–10:15: Sabine Ullmann (Eichstätt)
Kriegsflüchtlinge, die bleiben: Juden in der Reichsstadt Augsburg in Kriegszeiten
10:15–11:00: Monika Müller (Augsburg)
Jüdische Migration im Dreißigjährigen Krieg. Perspektiven aus Pfalz-Neuburg
11:30–12:15: Marion Schulte (Berlin)
Der Diskurs über die Einführung der Militärpflicht für Juden in Preußen (1787–1813)
12:15–13:00: Carsten Wilke (Budapest)
Eine heilige Pflicht. Rabbiner als Rekrutierungshelfer in den Napoleonischen Kriegen
13:00–13:30: Martha Keil (St. Pölten/Wien)
Abschluss
...weniger

Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling in der NS-Zeit. Aktuelle Forschungsergebnisse
9. Jänner 2019, 19 Uhr
Festsaal des Landesklinikums Mauer
Hausmeninger Straße 221, 3362 Mauer
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer
im Rahmen der Reihe „Gedenken – Nachdenken – Dokumentieren“ der Kulturabteilung der Stadt Amstetten.
mehr...
Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling war die drittgrößte Klinik der „Ostmark“, die im nationalsozialistischen System an der Ermordung von Psychiatrie-Patientinnen und -Patienten beteiligt war. Aufgrund des großen Publikumsandrangs bei den bisherigen beiden Terminen wird diese Veranstaltung, diesmal im Festsaal des Landesklinikums Mauer, bei freiem Eintritt wiederholt.
...weniger

Advent 1918. Der Krieg ist aus. Der Hunger bleibt.
14. Dezember 2018, 17 Uhr
Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
Eintritt frei
Programm
Begrüßung: Martha Keil, first-Sprecherin
Moderation: Sarah Pichlkastner
Julia Köstenberger: Niederösterreich 1918/19 – Protokoll einer chaotischen Zeit
Bernhard Bachinger: Krieg, Mangel, Hunger, Revolten – Ein Rückblick in die Kriegszeit
Christoph Lind: „Kukuruz gegen Holz abzugeben“ – Der Advent 1918 in der niederösterreichischen Regionalpresse.
Ulrich Schwarz-Gräber: Hunger und internationale Solidarität – Die neue Republik überlebt mit Hilfe.
mehr...
Weihnachten vor 100 Jahren: Vier Jahre Weltkrieg haben den Menschen unglaubliche Not, viel Hunger und Leid gebracht. Die Bevölkerung der noch jungen Republik (Deutsch-)Österreich lebt auch nach Kriegsende weiterhin im Dauermangel, mehr noch: Die Versorgung mit Lebensmitteln und Heizmaterial bricht in den ersten Friedensmonaten fast gänzlich zusammen. Der Zerfall des riesigen Habsburgerreiches verschärft die Situation. Die Regierung des Kleinstaates hofft auf internationale Hilfe. Kann man unter solch katastrophalen Umständen überhaupt Weihnachten feiern?
An diesem Abend geben ExpertInnen des niederösterreichischen Forschungsnetzwerks first anhand von zeitgenössischen Quellen erschütternde Einblicke in eine heute unvorstellbare Lebenswelt. Niederösterreich im Advent 1918 – ein verzweifelter Kampf ums Überleben.
Eine Veranstaltung des |Forschungsnetzwerks Interdisziplinäre Regionalstudien| (first) – Forschungsverbund „Nahrung und Ungleichheit“ in Kooperation mit dem |Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich|.
...weniger

„Migration erzählen“
Filmabend. Impulsvorträge. Aktionsnachmittag
Termine
Filmabend: 29.11., 18:30 – 21:00 Uhr
Impulsvorträge: 30.11., 9:00 – 12:00 Uhr
Aktionsnachmittag: 30.11., 13:00 – 17:00 Uhr
Ort: Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich, 3100 Sankt Pölten, Kulturbezirk 5.
Der |Forschungsverbund „Migration“| des |Forschungsnetzwerkes interdisziplinäre Regionalstudien| (first) lädt in Kooperation mit dem |Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich| zu einer dreiteiligen Veranstaltung zum viel diskutierten Thema Migration ein.
|Programm|
Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei! Um Anmeldungen per |mail: an romana.wurm@donau-uni.ac.at| von Schulklassen zum Aktionsnachmittag wird gebeten.
mehr...
Beim Filmabend ist „Last Shelter“, eine Dokumentation über die Flüchtlinge in der besetzten Votivkirche 2012, zu sehen. Regisseur Gerald Igor Hauzenberger steht im Anschluss für ein Gespräch zur Verfügung.
Unter dem Titel „Migration – forschen, sammeln, ausstellen. Lernen?“ geben Impulsvorträge Einblick in die Arbeit von ExpertInnen, die in Forschungseinrichtungen, Archiven, Museen und bei Initiativen tätig sind.
Am Aktionsnachmittag, der sich vor allem an KulturvermittlerInnen, LehrerInnen, Kinder und Jugendliche richtet, können im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich die Spuren von „Flucht und Wanderung“ in der Vergangenheit und heute auf verschiedenste Weise verfolgt werden. Bei einer Rätselrallye, in Gedankenspielen, Filmen und Gesprächen mit ExpertInnen erfahren die BesucherInnen viel über die Gründe und die Formen von Migration. Beim Infostand von KulturKontakt Austria erhalten LehrerInnen wertvolle Tipps und Anregungen für den Unterricht.
„Migration erzählen“ ist die öffentliche Abschlussveranstaltung des first-Forschungsverbundes „Migration“, der seine Arbeit in diesem Rahmen einem breiteren Publikum vorstellt.
...weniger

Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl
von Gerhard Zeilinger, Verlag Kremayr & Scheriau
Buchpräsentation
14. 11. 2018, 17:30
NÖ Landesbibliothek, Haus Kulturbezirk 3, Landeshauptplatz 1, 3109 St. Pölten
Begrüßung: Dr. Stefan Eminger
Gespräch: Martha Keil, Gerhard Zeillinger
Fragen aus dem Publikum
Zum Inhalt des Buches
mehr...
Walter Fantl ist vierzehn, als Hitler in Österreich einmarschiert, mit 18 wird er nach Theresienstadt, mit 20 nach Auschwitz deportiert. Gemeinsam mit seinem Vater geht er am 29. September 1944 über die Rampe von Birkenau, ahnungslos, was geschehen wird. Als der 21-Jährige im Juli 1945 nach Wien zurückkommt, ist ihm nichts von seinem Leben geblieben als ein breiter Ledergürtel: das Einzige, was er nach der Selektion behalten durfte. Bis zur Befreiung ist der Gürtel für ihn ein Überlebenssymbol, an das er sich jeden Tag klammert. Und bis heute ein Stück Erinnerung an die dunkelste Zeit seines Lebens: als er seine gesamte Familie verlor.
Heute ist Walter Fantl einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen in Österreich. Basierend auf jahrelangen Gesprächen und zahlreichen Originaldokumenten zeichnet der Historiker und Journalist Gerhard Zeillinger den bewegenden Lebensweg nach, der von der behüteten Kindheit in Bischofstetten in Niederösterreich direkt in den Horror der NS-Zeit und in die Stunde null nach der Befreiung mündet. Zeillingers dokumentarischerzählender Stil macht diese berührende Geschichte achtzig Jahre später noch einmal lebendig und schildert sehr eindringlich das Bild einer Zeit, die uns bis heute beschäftigt.
...weniger
Back to the Fatherland
Film und Gespräch. Eine Kooperation des Cinema Paradiso mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs
12.11.18, 20 Uhr
Cinema Paradiso, St. Pölten
Der Film „Back to Fatherland“ zeigt die dritte Generation bei ihrem Bemühen, sich eine Zukunft zu schaffen.
mehr...
NÖ-Premiere mit Regiseurinnen und ExpertInnen zu Gast
Die Regiseurinnen Gil Leyanon und Kat Rohrer sind Freunde seit College-Zeiten. Gil aus Israel ist die Enkelin eines Holocaust Überlebenden, Kat aus Österreich ist die Enkelin eines Nazi Offiziers. Trotz dieser biographischen Diskrepanz sind die beiden seit über 10 Jahren befreundet.
Nach dem Film Gespräch mit den Regisseurinnen sowie Dr. Christoph Lind und Dr. Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte in Österreich).
...weniger
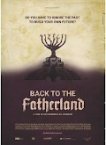
Gedenken und Forschen
Zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome
09.11.18, 18:30 – 21:00 Uhr
Am Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 gedenken wir der Gewaltereignisse des 8.-10. November 1938 und der Opfer der Judenvernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus.
mehr...
18:30 Uhr Ehemalige Synagoge
Gedenken an die vernichtete jüdische Gemeinde St. Pölten; beim Gedenkstein an der Außenmauer können Lichter (bitte ohne christliches Symbol) entzündet werden.
Weg im Schweigen zum Bildungshaus St. Hippolyt
19.00 Uhr Bildungshaus St. Hippolyt
Gedenken braucht Forschung
Das Team des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs gibt Einblicke in aktuelle Forschungen zum Nationalsozialismus
Moderation: Dr. Martha Keil
...weniger
Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling in der NS-Zeit. Aktuelle Forschungsergebnisse
7. November2018, 19 Uhr
Rathaussaal Amstetten
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer im Rahmen der Vortragsreihe
„Gedenken – Nachdenken – Dokumentieren“
Wiederholung der Veranstaltung aufgrund des großen Publikumsinteresses!
mehr...
2018 ist ein Gedenk- und Erinnerungsjahr. In Österreich wird unter anderem der 100. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik gefeiert und des Anschlusses Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland sowie des Novemberpogroms 1938 gedacht.
Die Stadtgemeinde Amstetten hat für das Veranstaltungsjahr 2018 daher den Programmschwerpunkt „Demokratie“ ausgerufen und ein umfangreiches und vielfältiges Angebot zusammengestellt.
Eine eigens konzipierte Reihe von sechs Vorträgen, in denen renommierte WissenschaftlerInnen zu Wort kommen, wird die Gedenkanlässe mit Fragen nach der Entwicklung der österreichischen Demokratie verknüpfen.
Weitere Informationen finden Sie |hier|.
...weniger
Die Wiener Leopoldstadt 1848
Ein Spaziergang auf den Spuren des jüdischen Tagebuchschreibers Benjamin Kewall
31. Oktober 2018 von 18:00 – 19:30
Treffpunkt: Nestroyplatz 1
Begleitet von Dr. Wolfgang Gasser und Dr. Christoph Lind
Bei einem Spaziergang durch den 2. Bezirk tauchen wir in die Lebenswelt eines jüdischen Wiener Tagebuchschreibers ein.
mehr...
Als Hauslehrer und Journalist schildert er die Wiener Revolution, die am 31. Oktober 1848 ihr Ende fand. Erst im Zuge von Recherchearbeiten konnte er als Benjamin Kewall (1806–1880) aus Polna/Böhmen identifiziert werden. Kewall beobachtete die Revolutionsereignisse buchstäblich „vor seiner Haustüre“ in der Jägerzeile, der heutigen Praterstraße. Seine Aufzeichnungen bieten ein vielschichtiges Bild der Wiener Gesellschaft, bestehend aus revolutionären Studenten und Arbeiter/innen, uniformierten Frauen und eingeschüchterten Beamten, schwarzgelben und roten Bürger/innen, den Rotmänteln des Jelačić und revolutionären Nationalgardisten. So abenteuerlich wie die Erlebnisse des Tagebuchschreibers ist auch die Fundgeschichte des Tagebuchs.
Begleitet vom Herausgeber von Kewalls Tagebuch begeben wir uns auf einen historischen Stadtspaziergang in das Wien der Mitte des 19. Jahrhunderts und erinnern an eine bürgerliche Revolution, die heute aus der kollektiven Erinnerung beinahe verbannt ist und nur zur runden Jubiläen erinnert wird.
...weniger

Nahrung und Ungleichheit
Interdisziplinärer Workshop des first-Forschungsverbunds
18.-19. Oktober 2018
Institut für Europäische Ethnologie, Universität Wien
Hanuschgasse 3, 1010 Wien
Nach zweijähriger, vom niederösterreichischen FTI-Programm geförderter Forschungstätigkeit präsentiert der first-Forschungsverbund „Nahrung und Ungleichkeit“ seine Ergebnisse beim interdisziplinären Workshop „Was uns Ernährung über Gesellschaft sagt“ an der Universität Wien. Neben aktuellen Forschungsergebnissen werden auch laufende Forschungsprojekte und geplante Forschungsvorhaben vorgestellt.
Programm und Information
mehr...
Donnerstag, 18. Oktober 2018
13:00 – 13:30
Begrüßung und Einleitung
Brigitta Schmidt-Lauber (Institutsvorständin am Institut für Europäische Ethnologie),
Ulrich Schwarz-Gräber (Leiter first-Forschungsverbund Nahrung)
13:30 – 14:30
Vortrag: Körperpolitiken des Essens in Vietnam
Judith Ehlert (Universität Wien)
14:30 – 15:00
Kaffeepause
15:00 – 16:30
Vortrag im Rahmen des Institutskolloquiums der Europäischen Ethnologie:
Wie und wieso essen ArbeiterInnen anders? Paris 1870 – 1914
Martin Bruegel (Alimentation et Sciences Sociales, Paris)
16:30 – 17:00
Kaffeepause
17:00 – 18:00
Projektvorstellung: The Future of Urban Food
Valentin Fiale (Universität für Bodenkultur, Wien)
19:00
Gemeinsames Abendessen
Freitag, 19. Oktober 2018
09:00 – 10:30
Vortrag: Spitäler und „Food Security“ in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Sarah Pichlkastner (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Universität Salzburg)
Vortrag: Koscher und arm in Wien bis 1914
Christoph Lind (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
Vortrag: „The Problem of Nutrition“ – Kalorien und „Volksgesundheit“ in der Zwischenkriegszeit
Ulrich Schwarz-Gräber (Institut für Geschichte des ländlichen Raumes)
10:30 – 11:00
Kaffeepause
11:00 – 12:00
Vortrag: Das Schicksal von Displaced Persons in Niederösterreich aus dem Blickwinkel der Lebensmittelversorgung
Bernhard Bachinger (Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung)
Vortrag: Zum Verhältnis von Essen und sozialer Arbeit
Veronika Reidinger (llse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung, FH St. Pölten)
12:00 – 12:45
Mittagsimbiss
12:45 – 14:00
Vorstellung der Publikation: Ermann / Langthaler / Penker / Schermer, Agro Food Studies, UTB (2018)
Ulrich Ermann (Universität Graz), Ernst Langthaler (Universität Linz), Marianne Penker (Universität für Bodenkultur, Wien)
Abschlussdiskussion: Wohin geht es mit den Food Studies (in Österreich)?
|Das Programm als pdf.|
Veranstalter: Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first) in Kooperation mit dem Forschungsschwerpunkt Wirtschaft und Gesellschaft aus historisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive der Universität Wien
Tagungsbüro und Kontakt:
first-Netzwerkmanagement
Donau-Universität Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems
Tel.: 02732 893-2555
Anmeldung: Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos, um Anmeldung bis zum 5.10.2018 wird gebeten! Anmeldung unter: Romana Wurm, romana.wurm@donau-uni.ac.at, Tel.: 02732 893-2555
first-Website:
|http://first-research.ac.at/|
...weniger

Verwischte Grenzen. Jüdische Verortungen nach 1918
Ausstellung in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten anlässlich des 30jährigen Bestehens unseres Instituts
Laufzeit der Ausstellung
18. Mai – 6. Oktober 2018
Dienstag – Sonntag, 13:00-19:00 Uhr
Eintritt frei
Führungen für Gruppen: auf |mail: Anfrage|

„Das Jahr 1918 markierte keineswegs das Ende der Vielvölkerreiche, im Gegenteil, sie vermehrten sich.“ (Pieter Judson)
mehr...
Anhand von zum großen Teil erstmals in Niederösterreich präsentierten Synagogalobjekten, Dokumenten, Fotos und Interviews zeigt die Ausstellung, wie sich nach dem Zerfall der Monarchie Juden und Jüdinnen in den Nachfolgestaaten politisch, sprachlich und auch in der Religionspraxis neu und kreativ orientierten. In 12 Stationen werden exemplarisch Haltungen, Bewegungen sowie politische und religiöse Entwürfe in den jüdischen Gemeinden und Gesellschaften dieser Staaten dargestellt: Österreich, Ungarn, Tschechoslowakische Republik, Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, Rumänien, Polen; davon Territorien mit starkem jüdischem Bevölkerungsanteil: Burgenland/Westungarn, Böhmen, Mähren, Slowakei, Bukowina, Galizien. Die einzelnen Regionen sind einerseits von ethnischer, sprachlicher, religiöser und kultureller Vielfalt und Austausch gekennzeichnet, andererseits führte die politische und materielle Unsicherheit verbunden mit Fragen der Identität und Zugehörigkeit zu Aggression, Exklusion und antisemitischer Gewalt.
...weniger

Lange Nacht der Museen
Samstag, 6. Oktober 2018, ab 17 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Auch heuer präsentieren wir im Rahmen der Langen Nacht der Museen wieder die St. Pöltner Jugendstil-Synagoge und geben Einblicke in unsere Arbeit. Gleichzeitig schließt mit der Langen Nacht die Ausstellung „Verwischte Grenzen. Jüdische Verortungen nach 1918“.
Programm
mehr...
18.00-18.20
Namen, Gräber und Gedächtnis. Gräber, Namen und Gedächtnis. Der NS-„Euthanasie“-Friedhof der „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling
Vortrag von Philipp Mettauer und Museum des Augenblicks
18.30-18.50
Das Treffen der Nachkommen der IKG St. Pölten 26.-30. Juni 2016 – Film und Folgen
Vortrag von Wolfgang Gasser
19.00-20.45
„Spheres“
Konzert mit dem Moritz Weiß Klezmer Trio
In der Pause: Koscheres Buffet von Waltraud Wawerka
21.00
„Verwischte Grenzen. Jüdische Identitäten nach 1918“
Letzte Führung durch die Ausstellung mit der Kuratorin Martha Keil
21.45-22.30
Wiederholung der Vorträge von Philipp Mettauer und Wolfgang Gasser
Nicht nur für Kinder: Mach dir einen Button mit deinem hebräischen Namen!
Eingang barrierefrei, jedoch nicht die WCs!
Auf Wunsch Führung durch das Haus.
...weniger

Die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling in der NS-Zeit. Aktuelle Forschungsergebnisse
27. September 2018, 19 Uhr
Rathaussaal Amstetten
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer im Rahmen der Vortragsreihe
„Gedenken – Nachdenken – Dokumentieren“
mehr...
2018 ist ein Gedenk- und Erinnerungsjahr. In Österreich wird unter anderem der 100. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik gefeiert und des Anschlusses Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland sowie des Novemberpogroms 1938 gedacht.
Die Stadtgemeinde Amstetten hat für das Veranstaltungsjahr 2018 daher den Programmschwerpunkt „Demokratie“ ausgerufen und ein umfangreiches und vielfältiges Angebot zusammengestellt.
Eine eigens konzipierte Reihe von sechs Vorträgen, in denen renommierte WissenschaftlerInnen zu Wort kommen, wird die Gedenkanlässe mit Fragen nach der Entwicklung der österreichischen Demokratie verknüpfen.
Weitere Informationen finden Sie |hier|.
...weniger
Kuratorinnenführung mit Martha Keil
Sonntag, 26. August 17:00 - 18:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
Führung durch die Ausstellung „Verwischte Grenzen. Jüdische Verortungen nach 1918“ mit der Kuratorin PD Dr. Martha Keil
Eintritt frei, Spenden erbeten!
„Bai mir bistu scheen“ und andere jiddische Liebeslieder
Konzert in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten
Sonntag, 19. August 2018, 18.00
Teilnehmer/innen des Workshops „Yiddish Lovesongs“
Klezmer Swing Quartett
Leitung: Roman Grinberg
Eintritt frei!
Verwischte Grenzen. Jüdische Identitäten in Zentraleuropa nach 1918
28. Internationale Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs
3.-6. Juli 2018, Volkskundemuseum Wien
In Kooperation mit dem Centrum für jüdische Studien Graz (Assoz.-Prof. Dr. Gerald Lamprecht)
|Programmfolder|
Das Ende des Ersten Weltkriegs 1918, der in Nord- und Osteuropa in weitere kriegerische Auseinandersetzungen mündete, manifestierte sich an vielen Orten als revolutionärer Systembruch von der Monarchie zur Republik, der von einer allgemeinen sozialen und ökonomischen Krise begleitet wurde. In den Nachfolgestaaten der ehemaligen Habsburgermonarchie wurden aus dem „Staatsvolk der Juden“ (Joseph Samuel Bloch) nationale oder religiöse Minderheiten, die ihre Position als solche noch zu behaupten hatten.
mehr...
Jüdinnen und Juden waren auch als Individuen an den Veränderungen und Umbrüchen aktiv beteiligt und/oder passiv davon betroffen. Sie waren in hoher Zahl Opfer von Gewalt und zugleich auch Akteure revolutionären Wandels und demokratischer Neugestaltung.
Jüdische Gemeinden wurden mit Forderungen nach Demokratisierung ebenso konfrontiert wie mit Verschiebungen der innerjüdischen Machtstrukturen in Folge des aufstrebenden Zionismus und einer Politisierung der Orthodoxie. Zugleich brachten der Krieg und sein Ende ein Erstarken des Antisemitismus in Wort und Tat mit sich. In Reaktion darauf wurden jüdische Milizen gegründet und andere Abwehrmaßnahmen getroffen.
...weniger

Wir danken für die Unterstützung:
Führung am jüdischen Friedhof St. Pölten
Donnerstag, 28. Juni 2018, 18.30
Es führt Dr. Martha Keil.
Treffpunkt: Eingang Karlstettner Straße 3
(das ist nicht der Haupteingang des allgemeinen städtischen Friedhofs)
Herren bitte mit Kopfbedeckung!
Teilnahme frei
„…frei und gleich an Würde und Rechten…“
So, 10. Juni 2018, 19.00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Konzert des Wiener Motettenchors unter Leitung von Andreas Peterl
Musik des Widerstandes gegen die Unmenschlichkeit
Weitere Informationen folgen!

„VWI invites INJOEST – Institut für Jüdische Geschichte Österreichs“
Mittwoch, 23. Mai 2018, 15.00 Uhr
VWI Research Lounge
Rabensteig 3, 3. Stock, 1010 Wien
Jacqueline Vansant
„Bitte vergeßt nicht, alle Briefe gut aufzuheben“: Agency in einem Briefwechsel ehemaliger österreichisch-jüdischer Schüler in der Emigration
Es muss in den Wochen kurz nach dem Anschluss gewesen sein. Eine Gruppe 15- bis 16-jähriger Schüler jüdischer Herkunft verabschiedet sich ‚für immer‘ auf der Schwedenbrücke in Wien. Es ist unsicher, wo sie landen werden und wie ihre Zukunft verlaufen wird. Die Schüler des traditionsreichen Franz-Joseph-Gymnasiums wissen nur, dass sie aus Wien wegmüssen, jedoch den Kontakt zueinander nicht verlieren wollen. Sie versprechen einander nicht nur zu schreiben, sondern hecken einen komplizierten Plan für eine Art Rundbrief aus. Aus dem Versprechen entsteht eine erstaunliche Korrespondenz und somit ein bedeutendes historisches Dokument.Bevor Vansant darauf eingeht, wie Agency in der Planung, Ausführung und Aufrechterhaltung des Briefwechsels ausgedrückt wird, verortet sie die Schüler in der Schule und in Wien und zeichnet ihre Exilwege kurz auf.
Kommentiert von Philipp Mettauer
Verwischte Grenzen. Jüdische Verortungen nach 1918
Ausstellung in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten anlässlich des 30jährigen Bestehens unseres Instituts
Eröffnung
Donnerstag, 17. Mai 2018, 18 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Musik
Roman Grinberg New Klezmer Trio
Roman Grinberg– Klavier, Gesang, Moderation
Sasha Danilov– Klarinette & Saxophon
Igor Pilyavskiy – Akkordeon & Flöten
In ihrem aktuellen Programm haben die Künstler alte und neue Klezmer-Melodien und viele beliebte jiddische Lieder zu einer bunten Collage zusammengestellt. Natürlich wird auch der jüdische Humor nicht zu kurz kommen.
Danach bitten wir zu einem Glas Wein!

„Anno 1338 kam es zur Vernichtung der Juden“
Die Pulkauer Verfolgung als Zäsur in der mittelalterlichen jüdischen Geschichte Niederösterreichs
Dienstag, 8. Mai 2018, 17:30 Uhr
Lesesaal der NÖ Landesbibliothek
Vortrag von PD Dr. Eveline Brugger und PD Dr. Birgit Wiedl
Im Jahr 1338 führte eine angebliche Hostienschändung durch Juden in Pulkau zu einer Welle blutiger Verfolgungen, die zahlreiche jüdische Ansiedlungen im Herzogtum Österreich, in Böhmen und in Mähren schwer in Mitleidenschaft zogen oder ganz auslöschten. Dieser erste überregionale Ausbruch antijüdischer Gewalt im mittelalterlichen Niederösterreich bildet einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der jüdischen Besiedlung des Landes und hatte weitreichende soziale, wirtschaftliche und politische Folgen, die in dem Vortrag nachgezeichnet werden sollen.
Außerdem soll am Beispiel der Pulkauer Verfolgung die Entwicklung antijüdischer Rhetorik und judenfeindlicher Stereotype in der Literatur und Kunst der Zeit mit ihren Auswirkungen auf die jüdische Lebensrealität und das christlich-jüdische Zusammenleben im Mittelalter und darüber hinaus analysiert werden
Begrüßung
wHR Dr. Anton Eggendorfer
Direktor des NÖ Landesarchivs i.R
Präsident des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich
|Programm|
Anmeldung bitte unter |post.k2veranstaltungen@noel.gv.at|, auf |aufhebenswert.at| oder unter 02742/9005-12835.
Jewish Evergreens
8. Mai 2018, 19.30
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, das Klezmer Swing Quartett und der Jüdische Chor Wien, Leitung: Roman Grinberg
Eintritt: Freie Spende
Geerbtes Schweigen
Bernhard Gitschtaler liest aus seinem Buch
26. April 2018, 19 Uhr
Rathaussaal Amstetten
Eintritt frei
1987 in Villach/Beljak geboren und aufgewachsen im Gailtal. Studium der Politikwissenschaften und Internationale Entwicklung an der Universität Wien sowie Soziale Arbeit an der FH-Campus WIen. Neben seiner Tätigkeit als Politikwissenschaftler und Autor ist er Vorstandsmitglied der Mauthausen Komitees Österreich und Sozialarbeiter bei der Caritas Wien.

Verpflegsklasse und „E-Kost“ – Mauer-Öhling 1914-45
Vortrag von Dr. Philipp Mettauer und Mag. Clemens Ableidinger im Rahmen des Forschungskolloquiums
Krieg und Psychiatrie. Lebensbedingungen und Sterblichkeit in österreichischen Heil- und Pflegeanstalten im Ersten und Zweiten Weltkrieg
Mittwoch, 25. April 2018, 15:45
Veranstalter: Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Es wird um Anmeldung bis spätestens 20.04.2018 gebeten:
|mail: office@schloss-hartheim.at| | +43-(0)7274-6536-546
|Programm |der gesamten Veranstaltung.
Lange Nacht der Forschung 2018
Freitag, 13. April 2018, 16.00-22.30
Haus der Geschichte im Museum NÖ
Unsere vertriebenen Nachbarn. Juden in Niederösterreich
Bis März 1938, dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland, existierten in Niederösterreich 15 jüdische Gemeinden. Alle wurden im Nationalsozialismus aufgelöst, die Menschen beraubt, vertrieben oder ermordet, die Synagogen und Friedhöfe zerstört. Haben an Ihrem Wohnort Juden und Jüdinnen gewohnt? Was wissen Sie von den vertriebenen Nachbarn Ihrer Familie? Forschen Sie mit uns!
mehr...
Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest) wurde 1988 gegründet und ist in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten untergebracht. Wir forschen, lehren, publizieren und sprechen zur jüdischen Geschichte, Kultur, den christlich-jüdischen Beziehungen und zur Judenfeindschaft vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Zur Station bringen wir Dokumente und Fotos mit, die das Leben in den einst blühenden Gemeinden beleuchten, aber auch die Beraubung und Vertreibung beschreiben. Unser online-Memorbuch, das der Opfer der Kultusgemeinde St. Pölten gedenkt, beinhaltet ebenfalls vielfältige Informationen. Sprechen Sie uns an und recherchieren Sie gemeinsam mit uns die jüdische Geschichte Ihres Heimat- und Wohnortes!
Unser neues Projekt erforscht die Euthanasie-Verbrechen an Menschen, die von den Nazis als „behindert“ und „lebensunwert“ erklärt wurden. In der „Landes- Heil und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling bei Amstetten kamen etwa 2000 Menschen gewaltsam ums Leben oder wurden in eine andere Anstalt in den Tod geschickt. Wenn Sie dazu Fragen oder Informationen haben, wenden Sie sich an uns!
Für Kinder und andere Neugierige: Schreib deinen Namen auf Hebräisch! (von 16.00-19.00)
...weniger
Jüdische Erfahrungen im Ersten Weltkrieg
Vortragsreihe des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs
am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung, Praterstern 1, 1020 Wien
22.2./1.3./8.3./15.3./22.3.2018, 18.30-20.00
Jahrzehntelang nahm der Erste Krieg im Familiengedächtnis vieler Juden einen zweitrangigen Platz ein. Das Erinnern an im Feld gefallene Familienmitglieder, an Flucht, Vertreibung, Hunger und Verlust war durch die Katastrophe der Shoah überlagert worden. In den letzten Jahren gelangten jedoch erstmals in großer Zahl Feldpostbriefe, Fotos und Tagebücher aus Familienarchiven in die Öffentlichkeit.
Programm
mehr...
- 22. Februar 2018
– Martha Keil (Wien/St. Pölten): Rabbinische Predigten und Erinnerungen zum Ersten Weltkrieg
– Gertrude Langer-Ostrawsky (St. Pölten): Zivilgesellschaftliches Engagement von Frauen in der Provinz
- 1. März 2018
Erwin Schmidl (Wien): Jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg und der Einsatz im Raum Palästina / Naher Osten
- 8. März 2018
Benjamin Grilj (St. Pölten): Jüdische Soldaten in den russischen Armeen. Rekrutierung, Aufstieg und Marginalisierung
- 15. März 2018
Christoph Lind (St. Pölten): Koscher im Krieg. Die Versorgung des jüdischen Wien mit ritueller Kost von 1914 bis 1918
- 22. März 2018
Gerald Lamprecht (Graz): Kampf um Erinnerung – Kampf um Anerkennung: Der Bund jüdischer Frontsoldaten Österreichs
...weniger
Neuentdeckte Hebräische Fragmente in Österreich: Herausforderungen und Chancen
11. Jänner 2018
19.15-20.45 Uhr (Juridicum, Schottenbastei 10-16, SEM 41)
Vortrag von Neri Y. Ariel, MA (Jerusalem)
im Rahmen des Jour Fixe – Geschichte der Juden in der Neuzeit
Moderation: PD Dr. Martha Keil (Wien/St.Pölten)
Veranstaltet von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte/ Universität Wien in Zusammenarbeit mit dem Institut für österreichische Geschichtsforschung und dem Injoest
„Forschen im Verbund - Ernährungsungleichheit | Migration. Sozialwissenschaftliches und historisches Nachdenken über zwei aktuelle Themen“
20. und 21. November 2017
Landesbibliothek St. Pölten
Landhausplatz 1, Haus Kulturbezirk 3
3109 St. Pölten
Als Mitglied des „Forschungsnetzwerks für Interdisziplinäre Regionalstudien (first)" möchten wir Sie zu unserer ersten Tagung einladen.
Im Rahmen der Tagung werden aktuelle Forschungsergebnisse aus den Forschungsverbünden „Migration" und „Nahrung und Ungleichheit" präsentiert. Die Themen der insgesamt elf Teilprojekte beschäftigen sich mit epochenübergreifenden Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Migrationen bzw. Mangelernährung und Nahrungsversorgung marginalisierter Gruppen vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften, die gesellschaftliche Phänomene in Langzeitperspektive analysiert, liefern die Forschungsergebnisse auch Impulse und Denkansätze für aktuelle Herausforderungen.
Nähere Informationen zum Forschungsnetzwerk first finden Sie online |hier|.
Das Konferenzprogramm finden Sie |hier|!
Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten:|mail: Daniela Wagner| oder Tel.: +43 (0)2732 893-2553

Debrecen. Ein Ghetto, viele Leidenswege
Freitag, 10. November 2017, 10:00 - 17:00
Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)
1010 Wien, Rabensteig 3, Research Lounge
Im Rahmen der ungebundenen Vortragsserie sprechen Christoph Lind und Philipp Mettauer (Injoest) zum Massaker in Hofamt Priel. Hans und Tobias Hochstöger berichten von der Entstehung ihres Dokumentarfilms „Das Schweigen der Alten“ zu diesem Ereignis.
Das Programm finden sie |hier|.
Um Anmeldung bis Mittwoch, 08.11.2017, 12 Uhr, wird nachdrücklich gebeten: |mail: anmeldung@vwi.ac.at|
Erinnern und Forschen
Schlussveranstaltung zum Top Citizen Science-Projekt
„Unsere vertriebenen Nachbarn. Juden im NÖ Zentralraum – Forschung und Erinnerungskultur“
Do, 9.11.2017
Am Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 schließen wir mit einem kurzen Gedenken und einer Ergebnispräsentation das Projekt „Unsere vertriebenen Nachbarn“ ab.
|Bericht von p3tv zur Veranstaltung|
mehr...
18:30 Uhr Ehemalige Synagoge
Gedenken an die vernichtete jüdische Gemeinde St. Pölten
Beim Gedenkstein können Lichter (bitte ohne religiöses Symbol) entzündet werden.
Weg im Schweigen zum Bildungshaus St. Hippolyt
19.00 Uhr Bildungshaus St. Hippolyt
Top Citizen Science-Projekt „Unsere vertriebenen Nachbarn“: Ergebnisse, Erfahrungen, Ausblick
- Das Historiker-Team des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (Dr. Christoph Lind und Dr. Philipp Mettauer) präsentiert Erfahrungen und Ergebnisse.
- Einige TeilnehmerInnen der Projekt-Workshops sprechen über ihre Eindrücke.
- Mag.a Roswitha Hammer vom Verein „Steine der Erinnerung“ stellt das Wiener Projekt vor.
- Dr. Martha Keil gibt einen Ausblick auf Forschung und Gedenken.
Moderation: Dr. Martha Keil
Der Abend ist für alle Interessierten offen, um Anmeldung per |mail: wird| gebeten.
Veranstaltungsort: Ehemalige Synagoge St. Pölten (Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten) und Bildungshaus St. Hippolyt (Eybnerstraße 5, 3100 St. Pölten)
Das Projekt „Unsere vertriebenen Nachbarn“ soll Informationen erschließen, an die Historiker nur schwer oder gar nicht herankommen: autobiographische Quellen, private Geschäftspapiere und vor allem Informationen aus der familiären Kommunikation.
Forschungsthemen sind die vielfältigen Aspekte des christlich-jüdischen Zusammenlebens vor dem Krieg – Nachbarschaft, Freundschaft, Schule, Vereine, Berufs- und Alltagsleben –, die Gewalt im Nationalsozialismus und etwaige Fortsetzungen der Beziehungen nach 1945.
Die Startveranstaltung am 02.02.2017 informierte über Anliegen, Inhalte und Arbeitsweisen des Projekts und wie Sie dazu beitragen können.
In monatlichen Workshops im Hippolythaus können Sie Ihre Materialien bringen und mit den Historikern des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs auswerten oder auf einem moderierten Blog ihre Beiträge diskutieren. Die Ergebnisse werden bei der Schlussveranstaltung am 09.11.2017 präsentiert und unter Beachtung des Datenschutzes auf dem „Memorbuch“ online gestellt.
ReferentInnen
PD Dr. Martha Keil, Dr. Christoph Lind, Dr. Philipp Mettauer
Institut für jüdische Geschichte Österreichs (St. Pölten)
Veranstalter
Institut für jüdische Geschichte Österreichs in Kooperation mit dem
Bildungshaus St. Hippolyt
Information und Anmeldung
|mail: Dr. Martha Keil|, Institut für jüdische Geschichte Österreichs, 02742-77171-0. Anmeldung erbeten!
Zur jüdischen Geschichte St. Pöltens: |www.juden-in-st-poelten.at|
Bisherige Veranstaltungen
Startveranstaltung: Do, 2.2.2017, 19 Uhr
Workshops: Mi, 15.2.201, 18 – 20 Uhr; Di, 14.3.2017, 18 – 20 Uhr; Fr, 21.4.2017, 18 – 20 Uhr; Do, 11.5.2017, 18 – 20 Uhr; Mo, 26.6.2017, 18 – 20 Uhr; Di, 12.9.2017, 18-20 Uhr
Im Rahmen des Juni-Workshops berichteten die Brüder Hans und Tobias Hochstöger über ein besonders dunkles Ereignis unserer Geschichte: In der Nacht von 2. auf 3. Mai 1945 wurden im niederösterreichischen Hofamt Priel 228 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter - Männer, Frauen und Kinder - ermordet. Die Täter, die auch Hilfestellung von Einheimischen mit Ortskenntnissen erhalten haben müssen, konnten nie ausgeforscht und daher auch nicht verurteilt werden. 1964 wurden die Leichen auf den jüdischen Friedhof St. Pölten überführt und in einem Massengrab beerdigt. Im Ort wurde das Verbrechen totgeschwiegen, und geriet langsam in Vergessenheit. Erst 2006 wurde das Massaker auch durch Forschungen am Injoest wissenschaftlich dokumentiert. Am 70. Jahrestag des Massakers, am 3. Mai 2015, erhielten die Ermordeten endlich einen Grabstein mit allen Namen. (Weitere Informationen finden Sie |hier|!)
Hans und Tobias Hochstöger, beide aufgewachsen in Hofamt Priel, arbeiten seit 2015 an einem Dokumentarfilm zum Massaker. Im Zuge ihres Filmprojekts begaben sie sich auf die Suche nach den Hintergründen dieses Verbrechens. In ihrer Präsentation werden die beiden über ihre Recherchen zum Massaker und den daraus entstehenden Dokumentarfilm berichten.
Im Rahmen des September-Workshops wurde ein spannendes Projekt vorgestellt: Seit dem 19. Jahrhundert lebten in vielen Gemeinden der Buckligen Welt und des Wechselgebiets jüdische Familien, die vor allem aus dem benachbarten Westungarn zugewandert waren. Der März 1938 markierte auch für die Jüdinnen und Juden im südöstlichen Niederösterreich einen dramatischen Wendepunkt: Verfolgung – Vertreibung – Ermordung.
Mehr als siebzig Jahre später begann ein Projektteam, das sich vorwiegend aus engagierten BürgerInnen vor Ort zusammensetzt, mit der Spurensuche. Johann Hagenhofer und Gert Dressel, die gemeinsam mit Werner Sulzgruber dieses Projekt leiten, stellten Hintergründe und erste Ergebnisse vor.
...weniger


„Geschlossene Anstalt? Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis“
17.10. 2017, 18:30 Uhr
Rathaus Amstetten
Wegen des großen Interesses wird die Veranstaltung zum Start des Sparkling Science-Projekts wiederholt: Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs setzt sich mit diesem Projekt zum Ziel in Kooperation mit dem Aufbaulehrgang Wirtschaft (Fachschule Amstetten), dem Niederösterreichischen Landesarchiv und dem Stadtarchiv Amstetten diesen Teil der Geschichte Mauer-Öhlings näher zu beleuchten.
|Bericht von M4-tv zur Veranstaltung|
Programm
mehr...
18:30 Uhr
Begrüßung
18:40 Uhr
„Nebel im August“ (Film)
Die authentische Geschichte von Ernst Lossa, Psychiatriepatient der frühen 1940er Jahre.
Länge 126 Minuten. Regie: Kai Wessel, Drehbuch: Holger Karsten Schmidt, nach Motiven des gleichnamigen Tatsachenromans von Robert Domes. Mit: Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt.
Der 13-jährige Ernst Lossa, Sohn fahrender Händler und Halbwaise, ist ein aufgeweckter, aber unangepasster Junge. Die Kinder- und Erziehungsheime, in denen er bisher lebte, haben ihn als „nicht erziehbar“ eingestuft und schieben ihn schließlich wegen seiner rebellischen Art in eine Nervenheilanstalt ab. Nach kurzer Zeit bemerkt er, dass unter der Klinikleitung von Dr. Veithausen Insassen getötet werden. Er setzt sich zur Wehr und versucht den Patientinnen und Patienten zu helfen. Schließlich plant er die Flucht, gemeinsam mit Nandl, seiner ersten Liebe. Doch Ernst befindet sich in großer Gefahr, denn Klinikleitung und Personal entscheiden über Leben und Tod der Kinder. (|www.filmladen.at/ilm/nebel-im-august/|)
20:40 Uhr
Historische Information durch den Historiker Philipp Mettauer,
danach Publikumsgespräch, Moderation Thomas Buchner (Stadtarchiv Amstetten)
...weniger
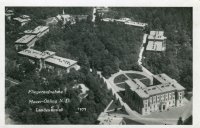

Lange Nacht der Museen 2017
7. 10. 2017, 18–24 Uhr
Programm
18.00-18.45
Philipp Mettauer, Wolfgang Gasser
Die „Landes- Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling“ in der NS-Zeit

19.00-20.00
Roman Grinberg (Leiter des Wiener jüdischen Chors)
„Oj, hab ich gelacht! Der Jüdische Humor in Wort und Musik“
mehr...
Auf der ganzen Welt widmen sich Künstler dem berühmten jüdischen Humor. Er ist dicht und dichterisch, überraschend und verständlich zugleich, aus dem Leben gegriffen und verpackt in Lieder, Witze, Geschichten und Gedichte. Vom und über das Volk, das über die eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten so herrlich lachen kann. Roman Grinberg bringt eine Collage aus 100 Jahren Tradition – in Wort und Musik.
20.00-20.30
Christoph Lind
„Arisierung“ und Restitution der „Wilhelmsburger Steingutfabrik“
und
Museum des Augenblicks
20.30-21.00
Roman Grinberg
Lomir singen! Lasst uns singen!
Offener Chorworkshop
21.30-22.00
Philipp Mettauer, Wolfgang Gasser
Die „Landes- Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling“ in der NS-Zeit
Auf Wunsch Führung durch das Haus.
Nicht nur für Kinder: Mach dir einen Button mit deinem hebräischen Namen!
Anmerkung: Eingang barrierefrei, jedoch nicht die WCs!
...weniger

„Geschlossene Anstalt? Die „Heil- und Pflegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis“
Veranstaltung zum Start des Sparkling Science-Projekts
14. 9. 2017, ab 18 Uhr
Rathaussaal Amstetten
Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs setzt sich mit diesem Projekt zum Ziel in Kooperation mit dem Aufbaulehrgang Wirtschaft (Fachschule Amstetten), dem Niederösterreichischen Landesarchiv und dem Stadtarchiv Amstetten diesen Teil der Geschichte Mauer-Öhlings näher zu beleuchten.
Programm
mehr...
18:00 Uhr
Grußworte von Ulrike Königsberger-Ludwig
(Abg. zum NR, Vizebürgermeisterin Amstettens und Behindertensprecherin der SPÖ)
Martha Keil (Direktorin Injoest) berichtet über das Sparkling-Science-Projekt: „Geschlossene“ Anstalt? Die „Heil- und Plegeanstalt“ Mauer-Öhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis – eine Kooperation des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest) mit der Fachschule Amstetten, dem Stadtarchiv Amstetten und dem Niederösterreichischen Landesarchiv
18:20 Uhr
„Nebel im August“ (Film)
Die authentische Geschichte von Ernst Lossa, Psychiatriepatient der frühen 1940er Jahre.
Länge 126 Minuten. Regie: Kai Wessel, Drehbuch: Holger Karsten Schmidt, nach Motiven des gleichnamigen Tatsachenromans von Robert Domes. Mit: Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt.
Der 13-jährige Ernst Lossa, Sohn fahrender Händler und Halbwaise, ist ein aufgeweckter, aber unangepasster Junge. Die Kinder- und Erziehungsheime, in denen er bisher lebte, haben ihn als „nicht erziehbar“ eingestuft und schieben ihn schließlich wegen seiner rebellischen Art in eine Nervenheilanstalt ab. Nach kurzer Zeit bemerkt er, dass unter der Klinikleitung von Dr. Veithausen Insassen getötet werden. Er setzt sich zur Wehr und versucht den Patientinnen und Patienten zu helfen. Schließlich plant er die Flucht, gemeinsam mit Nandl, seiner ersten Liebe. Doch Ernst befindet sich in großer Gefahr, denn Klinikleitung und Personal entscheiden über Leben und Tod der Kinder. (|www.filmladen.at/ilm/nebel-im-august/|)
20:30 Uhr
Publikumsgespräch mit dem Historiker Philipp Mettauer, Moderation
Thomas Buchner (Stadtarchiv Amstetten)
...weniger
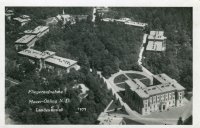

„Wer war Rosl Lustig?“
Unsere „Forschungsstation“ im Rahmen des Forschungsfests Niederösterreich
15.9. 2017, 15.00-23.00
Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien
Nicht zufällig im sogenannten „Bedenkjahr“ 1988 wurde das Institut für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest) gegründet und fand in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten seine Wirkungsstätte. Forschungsthemen sind Migration und Kulturaustausch, Integration und Ausgrenzung, Antisemitismus und Erinnerung vom Mittelalter bis heute. Wir sorgen dafür, dass Menschen wie Rosl Lustig nicht vergessen sind.
Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr!
Für Kaiser und Vaterland. Jüdische und nichtjüdische Erfahrungen im Ersten Weltkrieg
27. Internationale Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs in Kooperation mit dem Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (first), dem Volkskundemuseum Wien und den Wiener Vorlesungen
5. – 7. Juli 2017
Volkskundemuseum Wien
Wien 8, Laudongasse 15-19
Der Erste Krieg nahm im Familiengedächtnis vieler Juden jahrzehntelang einen zweitrangigen Platz ein. Das Erinnern an im Feld gefallene Familienmitglieder, an Flucht, Vertreibung, Hunger und Verlust war durch die Katastrophe der Shoah überlagert worden. In den letzten Jahren gelangten erstmals in großer Zahl Feldpostbriefe, Fotos und Tagebücher aus den Familienarchiven in die Öffentlichkeit. Darauf fußend fokussieren die Beiträge der Tagung drei Schauplätze des Kriegsgeschehens – Feld, Heimatfront, Flucht – und stellen vor diesen Hintergründen jüdische und nichtjüdische Erfahrungen vergleichend gegenüber.
|Programmfolder|
Aufgrund zweier Absagen gilt das |neue Programm|!


Themenrundgang 2017
29. Mai 2017, 18.30
Martha Keil führt auf dem jüdischen Friedhof St. Pölten.
Treffpunkt: Neuer jüdischer Friedhof St. Pölten, Karlstettner Straße 3, 3100 St. Pölten

Museumsfrühling Niederösterreich
Samstag, 20.5.2017
Ehemalige Synagoge St. Pölten, 19.00 – 21.00
Am Samstag, dem 20. Mai, erwacht die Ehemalige Synagoge St. Pölten aus ihrem Winterschlaf und öffnet ihre Tore für die interessierte Öffentlichkeit.
Ab 19.00 kann das Haus inklusive der Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte der Stadt besichtigt werden. Dabei stehen die Spezialisten für die Geschichte des Gebäudes, Dr. Philipp Mettauer und Dr. Christoph Lind vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs für alle Fragen zur Verfügung.
Um 21.00 begeben sich die beiden Historiker, unterstützt vom örtlichen Verein „Freiluft und Kultur“ und Dr. Christian Klösch vom Technischen Museum Wien, auf Spurensuche nach der jüdischen Vergangenheit St. Pöltens. Dabei werden begleitend zu den historischen Informationen Fotos und Filme auf die Hauswände projiziert.

Museum des Augenblicks
Sonntag, 21. Mai 2017
Ehemalige Synagoge St. Pölten, ab 17.00
Im „Museum des Augenblicks“ präsentiert das |„Netzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien“ (first)|, bestehend aus fünf geistes- und kulturwissenschaftlichen Instituten mit Sitz in Niederösterreich, in kleinen mobilen Ausstellungen und Medieninstallationen an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten seine Arbeit. Auch das Institut für jüdische Geschichte Österreichs ist first-Partner. Im Rahmen des „Museumsfrühling Niederösterreich“ wird das „Museum des Augenblicks“ in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten zu zwei Forschungsprojekten vorgestellt.
Programm
17.30: Dr. Martha Keil (Direktorin des Injoest) spricht zum „Museum des Augenblicks“ und zum Top Citizen Science-Projekt „Unsere vertriebenen Nachbarn: Juden im NÖ Zentralraum – Forschung und Erinnerungskultur“
18.00: Dr. Christoph Lind (Injoest) berichtet zum first-Projekt „Koscher im Krieg“ – Die Versorgung mit rituellen Speisen im Ersten Weltkrieg
18.30–20.00: Lomir singen! – Lasst uns singen!
Offener Singworkshop mit „Ein Weltchor. A Wöd Chor. A World Chorus“ (St. Pölten) und Roman Grinberg, Leiter des Wiener Jüdischen Chors. Gemeinsam werden Lieder aus der jüdischen Tradition erarbeitet und gesungen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.
Im Weltchor kann jede/r mitsingen, gleichgültig ob sie/er Noten lesen kann oder jeden Ton trifft – im Vordergrund steht die Freude am Singen.
Eine Kooperation des Injoest mit dem Festspielhaus St. Pölten und dem Büro für Diversität St. Pölten.
20.30: Martha Keil und Christoph Lind führen durch die Synagoge

„Den neuen Mietern zur treuhändigen Verwahrung übergeben“
Die Räumungen von „Judenwohnungen“ im Auftrag von „Vugesta“ und „Zentralstelle“
3. 5. 2017
16:45 – 18:30, Universitätsbibliothek Wien
Vortrag von Philipp Mettauer im Rahmen der Tagung „Treuhänderische“ Übernahme und Verwahrung – international und interdisziplinär betrachtet – Panel „Wien“
Universitätsbibliothek der Universität Wien, 2.–4. Mai 2017
|Information und Programm|
Nebel im August
4. 4. 2017
Film + Gespräch mit Philipp Mettauer
Ein verdrängtes Tabuthema. Euthanasie an Kindern und Jugendlichen im Nazi-Reich. Wer nicht der nationalsozialistischen Rassenideologie entspricht, wird in Heime gesperrt, in denen die Insassen systematisch ermordet werden. So soll es auch dem 13 Jahre alten Ernst Lossa ergehen, einem Kind fahrender Händler. Der aufgeweckte Bub wird als nicht erziehbar eingestuft und landet in einer Nervenheilanstalt. Ihm wird schon wenig später klar, dass die inhaftierten Kinder ermordet werden. Gemeinsam mit seiner ersten großen Liebe Nandl plant er die Flucht. Eine wahre Geschichte.
Kai Wessel gelingt ein unheimlich menschlicher Film – was vor allem daran liegt, dass er seinem jungen Protagonisten zugesteht, noch so viel mehr zu sein als nur ein Opfer, nämlich ein Teenager mit Ecken und Kanten und Hoffnungen. Eine Lektion darüber,
dass das Verdrängen der eigenen Geschichte die Gesellschaft irgendwann einholen wird. Vor Kurzem hat ein österreichischer Politiker vorgeschlagen, besachwalteten Menschen das Wahlrecht zu entziehen. Eine Motiva tion dieses großartigen Films lautet: Wehret den Anfängen!
4.4.17, 19.45 Uhr
Film + Gespräch, Lehrkräfte gegen vorherige Anmeldung freier Eintritt.
Der Film ist über Greta und Starks barrierefrei verfügbar.
Ö/D 2016, Originaltitel: Nebel Im August; Regie: Kai Wessel, Buch: Holger Schmidt; Kamera: Hagen Bogdanski, Musik: Martin Todsharow; Darsteller: Ivo Pietzcker, Sebastian Kocher, Thomas Schuber, Karl Markovics u.a.; Version: DF, Prädikat: bes. wertvoll, Filmdauer: 121min; Altersfreigabe: ab 14 Jahren
In die Häuser schauen. Aspekte jüdischen Wohnens vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
16.2. – 23.3.2017, 18:30 – 20:00
Vortragsreihe in Kooperation mit dem Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
6 Vorträge (pro Vortrag € 6,-)
Praterstern 1, 1020 Wien
Freiwilliges Zusammenleben in Judenvierteln und gewaltsame Ansiedlung in Ghettos, bürgerliche Wohnräume und überfüllte „Sammelwohnungen“ – zwischen diesen Extremen konnte sich jüdisches Wohnen durch die Jahrhunderte europäischer Geschichte gestalten. Die Vorlesungsreihe stellt unter einem kulturhistorischen und alltagsgeschichtlichen Blick unterschiedliche Wohn- und Lebensformen vor und diskutiert Begriffe wie „Judenhaus“ und „Ghetto“, „Transit“ und „Repräsentation“ im historischen Bedeutungswandel vom Mittelalter bis in die Zeitgeschichte.
16.2.2017, 18:30–20:00
Dr. Eveline Brugger
Under des egenanten juden dach – „Judenhäuser“ im mittelalterlichen Österreich
23.2.2017, 18:30–20:00
Mag. Elisabeth Loinig
Von den Christen soviel es immer möglich abgesondert ... Jüdisches Wohnen in Wien im 18. Jahrhundert
2.3.2017, 18:30–20:00
Mag. Sabine Bergler
Palais verpflichtet - Wohnen und Leben der jüdischen Großbourgeoisie an der Wiener Ringstraße
9.3.2017, 18:30–20:00
Dr. Christoph Lind
In Wohnungen und Lagern. Jüdische Flüchtlinge in Niederösterreich (1914-1918)
16.3.2017, 18:30–20:00
Dr. Philipp Mettauer, Mag. Iris Palenik, Dr. Michaela Raggam-Blesch
„Sammelwohnungen“ in der NS-Zeit (Podiumsdiskussion)
23.3.2017, 18:30–20:00
Mag. Birgit Johler
Möbel aus Freuds Dining Room, London – eine Beziehungsgeschichte
Drei Generationen. Shoah und Nationalsozialismus im Familiengedächtnis
Buchpräsentation
Dienstag, 31. Jänner 2017, 20-22 Uhr
Sigmund Freud Museum
Berggasse 19, 1090 Wien
- Monika Pessler (Direktorin des Sigmund Freud Museums)
Begrüßung
- Philipp Mettauer und Martha Keil (beide Injoest, St. Pölten)
Einführung
- Jürgen Müller-Hohagen (Dachau)
Die seelischen Auswirkungen der NS-Zeit auf Nachkommen von Tätern und Mitläufern
- Renate Stockreiter
liest Texte aus dem Buch
- Nina Flurina Caprez (Zürich)
spricht mit ihrer Mutter Lilian über die Spuren der Shoah bei ihrer überlebenden Großmutter und deren Nachkommen
Anschließend Getränkebuffet
Unsere Sommerakademie 2013 zum Thema „Drei Generationen. Shoah und Nationalsozialismus im Familiengedächtnis“ stieß auf reges Interesse: Rund 220 Teilnehmer/innen hörten die Vorträge, führten intensive Diskussionen und berührten durch persönliche Beiträge. Nun ist im StudienVerlag der gleichnamige Tagungsband erschienen, 312 Seiten, € 29,90. Weitere Informationen zum Band finden Sie |hier|.
Bestellung des Bandes beim |Verlag|.

Ein goldenes Zeitalter? Das jüdische St. Pölten 1880 bis 1918
Vortrag von Dr. Christoph Lind im Rahmen der Tagung „Aufstieg & Niedergang. St. Pölten 1880 bis 1918“
24. November 2016, 15:30-16:00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
|Tagungsprogramm|
Anmeldung zur Tagung unter 02742/33-2602 oder per |mail: kultur@st-poelten.gv.at|.
Gedenken an die Novemberpogrome und Filmpräsentation
Dienstag, 8. November 2016
17.00, Ehemalige Synagoge, St. Pölten, Dr. Karl-Renner-Promenade 22
Gedenken an die Novemberpogrome
Christoph Lind: Die Novemberpogrome in der Synagoge St. Pölten
Philipp Mettauer: „Wohnungsarisierungen" im November 1938
Schweigeminute
Wer möchte, kann bei den Gedenksteinen Grablichter (bitte ohne christliche Symbole) entzünden.
Danach gehen wir gemeinsam ins Cinema Paradiso.
Anschließend um 18.00, Cinema Paradiso, St. Pölten, Rathausplatz 14
Filmpräsentation
„In the Footprints of our Families. Descendants' Reunion of the former Jewish Community in St. Pölten, June 2016"
Von Bernadette Dewald, im Auftrag des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, 2016, engl. u. deutsch, ca. 40 Minuten
Vom 26.-29. Juni 2016 trafen einander 92 Nachkommen ermordeter und vertriebener jüdischer Familien aus St. Pölten und Umgebung. Der Dokumentarfilm fängt die Schauplätze – Synagoge, Friedhof, Wohnorte – und die Atmosphäre dieses Treffens ein.
Einleitung: Martha Keil
Anschließend: Podiumsgespräch mit Tina Frischmann, Wolfgang Gasser, Hans Morgenstern, Elisabeth Schiepek, Ruth Spitzer u. a.
Eintritt frei
Chapeau! Eine (jüdische) Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes
15. Oktober, 16.00-17.00, Wien Museum
Kuratorinnenführung mit Barbara Staudinger, Treffpunkt im Foyer
Kleider machen Leute - am deutlichsten zeigt sich dies am Kopf. Kopfbedeckungen sind immer auch Zeichen für Stand, Identität, politische Haltung oder religiöse Gesinnung. Ein Gang durch rund 170 Jahre Wiener Hutgeschichten zeigt, wie sehr die jüdische Geschichte in die Wiener Stadtgeschichte eingeschrieben ist. Die Ausstellung erzählt anhand einzelner Hüte von diskriminierender Politik der Kopfbedeckungen, jüdischen Modistinnen und Hutmachern, sie kontextualisiert religiöse Kopfbedeckungen und lädt zur Reflexion über Projektionen und Vorurteile ein.
Kosten
Der Gruppentarif von 7 EUR/Person ist für den Eintritt zu zahlen, die Führung selbst ist kostenlos!
Lange Nacht der Museen
1. Oktober 2016, 18.00-24.00
Konzert „Out of Sight“ (19.00 UHR)
Die Sopranistin Ethel Merhaut und der Pianist und Komponist Bela Koreny bringen selten Gehörtes aus den musikalischen Schätzen vertriebener Komponisten zu Gehör.
Vortrag (20.30 UHR) „Ornamentik und Farbenwelt in Synagogen”
Herbert Peter (Akademie der Bildenden Künste Wien) gibt anhand der originalen
Malerei-Schablonen von der Restaurierung dieser Synagoge einen Einblick in diese Thematik.
Führung (22.00 UHR)
Christoph Lind und Philipp Mettauer führen durch die Synagoge
und erzählen die Geschichte der vernichteten jüdischen Gemeinde.
Für Kinder und andere Interessierte: Kreative Malschablonen für Davidsterne.
Die Wiener Leopoldstadt 1848 – Ein Spaziergang auf den Spuren des jüdischen Tagebuchschreibers Benjamin Kewall
23. September 2016, 18:30-20:00
Treffpunkt: Nestroyplatz 1 (U1)
Begleitet von Dr. Wolfgang Gasser
Bei einem Spaziergang durch den 2. Bezirk tauchen wir in die Lebenswelt eines jüdischen Wiener Tagebuchschreibers ein. Als Hauslehrer und Journalist schildert er die Wiener Revolution von 1848. Da er sich darin nicht mit Namen nennt, konnte er erst im Zuge von Recherchearbeiten als Benjamin Kewall (1806–1880) aus Polna/Böhmen identifiziert werden. Kewall beobachtete die Revolutionsereignisse buchstäblich „vor seiner Haustüre“ in der Jägerzeile, der heutigen Praterstraße. Seine Aufzeichnungen bieten ein vielschichtiges Bild der Wiener Gesellschaft, bestehend aus revolutionären Studenten und Arbeiter/innen, uniformierten Frauen und eingeschüchterten Beamten, schwarzgelben und roten Bürger/innen, den Rotmänteln des Jelačić und revolutionären Nationalgardisten. So abenteuerlich wie die Erlebnisse des Tagebuchschreibers ist auch die Fundgeschichte des Tagebuchs.
Begleitet vom Herausgeber von Kewalls Tagebuch begeben wir uns auf einen historischen Stadtspaziergang in das Wien der Mitte des 19. Jahrhunderts und erinnern an eine bürgerliche Revolution, die heute aus der kollektiven Erinnerung beinahe verbannt ist.
„In die Häuser schauen.“ Aspekte jüdischen Wohnens vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert
26. Internationale Sommerakademie 2016
6.-8.7.2016, Campus WU Wien
In Kooperation mit dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien und den Wiener Vorlesungen
|Programmfolder|
Zum Inhalt:
Freiwilliges Zusammenleben in Judenvierteln und gewaltsame Ansiedlung in Ghettos, bürgerliche Wohnräume und überfüllte „Sammelwohnungen“ – zwischen diesen Extremen konnte sich jüdisches Wohnen durch die Jahrhunderte europäischer Geschichte gestalten. Die Tagung stellt unter einem kulturhistorischen und alltagsgeschichtlichen Blick unterschiedliche Wohn- und Lebensformen vor und diskutiert Begriffe wie „Judenhaus“ und „Ghetto“, „Transit“ und „Repräsentation“ im historischen Bedeutungswandel vom Mittelalter bis in die Zeitgeschichte.

Den „vergessenen“ Krieg einem jungen Publikum vermitteln: Schulprojekte und Arbeit mit Jugendlichen
Vortrag von Dr. Wolfgang Gasser im Rahmen des 36. Symposions des NÖ Instituts für Landeskunde "Ungewisse Wege. Flucht, Vertreibung, Genozid zur Zeit des
Ersten Weltkriegs"
5. Juli 2016, 14:30-17:30, Amstetten
Hier finden Sie das gesamte |Tagungsprogramm|!
Zwischen Burg und Judengasse
Tagung zum 65. Geburtstag von Markus J. Wenninger
16. und 17. Juni 2016
Stiftungssaal der Universität Klagenfurt
In Kooperation mit der Abteilung für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften am Institut für Geschichte an der Universität Klagenfurt und dem Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden an der Universität Trier.
|Programm|
„Es gab so nette Leute dort.“ Die Zerstörung der jüdischen Gemeinde St. Pölten 1938-1945
Vortrag von Dr. Christoph Lind im Rahmen der Tagung „Migrations- und Fluchtgeschichte(n). Geschichte, Politik, Literatur”
3.6.2016, 13:15 – 14:00
Hippolyt-Haus, Eibnerstr. 5, 3100 St. Pölten
Die Tagung findet von Donnerstag, 2.6.– Samstag, 4.6.2016 statt.
Veranstalter:
Institut für Österreichkunde, Wien, in Kooperation mit dem
Institut für Deutschdidaktik, Universität Klagenfurt
Informationen zur Tagung
mehr...
Migration und Flucht stellen nicht nur ein allseits wahrgenommenes Problem der Tagespolitik dar, sie sind auch eine Herausforderung für die Wissenschaft: Es geht darum, sich diesen Phänomenen allseitig anzunähern, um so ein facettenreiches und mit historischer Tiefenschärfe ausgestattetes Gesamtbild zu zeichnen. Insbesondere vom Zusammenwirken von Geschichtswissenschaften mit den Literaturwissenschaften und der Literatur selbst sind hier neue Aspekte zu erwarten. Literatur, als der vielleicht feinste Seismograph gesellschaftlicher Veränderungen, hat Migration schon längst zu einem ihren hauptsächlichen Themen gemacht:
„Während einst die Weitergabe nationaler Traditionen das Hauptthema einer Weltliteratur war, können wir jetzt möglicherweise annehmen, dass transnationale Geschichten von Migranten, Kolonisierten oder politischen Flüchtlingen – diese Grenzlagen – die Gebiete der Weltliteratur sein könnten“, formuliert Homi Bhabha in seinem literaturwissenschaftlichen Standardwerk Die Verortung der Kultur.
Tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen Migration, Politik und Literatur allerdings wesentlich älter und reicht in die Anfänge der (europäischen) Literatur zurück. Man denke nur an die Geschichte von Aeneas, dem Flüchtling als Troia, der als Staatengründer Roms gilt. Vergils Aeneis, das Epos über diesen „Migranten“, wurde ein Instrument zur Schaffung der römischen Staatsidentität.
Diesen weiten Blick zu vermitteln ist die Domäne der Geschichtswissenschaften. „Vom Thema Migration aus, das in der institutionalisierten Zeitgeschichte bislang marginalisiert ist, lässt sich die österreichische und damit auch eine europäische Zeitgeschichte neu erschließen sowie räumlich und zeitlich neu konfigurieren“, heißt es zum Beispiel in der Beschreibung eines aktuelles FWF-Projekts an der Universität Innsbruck.
Die geplante Tagung will diese aktuelle Thematik von verschiedenen historischen und ästhetischen Gesichtspunkten aus betrachten: Wie erinnern Romane und Erzählungen, Gedichte und Filme migratorische Erfahrungen? Wieweit sind Begriffe wie Migrationsliteratur berechtigt und zutreffend? Wie greift Literatur in die Diskurse über Migration ein? Welche ästhetischen Verfahren werden angewandt? Wieweit ändert die „interkulturelle“, die „mehrsprachige“, die „Migrationsliteratur“ das Selbstverständnis von Literatur und Literaturhistorie?
...weniger
Führung auf dem Neuen jüdischen Friedhof St. Pölten
mit Martha Keil
Donnerstag, 19. Mai, 18.00
St. Pölten, Karlstettner Straße 3
Ein jüdischer Friedhof ist unauflöslich, auch wenn seine Gemeinde zerstört ist. Der Grabstein ist Eigentum des Toten, auch wenn niemand sein Grab pflegen kann. Die Führung gibt Einblick in jüdische Toten- und Trauerbräuche und vermittelt die Geschichte und Vernichtung der einst blühenden Kultusgemeinde St. Pölten.
Die männlichen Teilnehmer werden ersucht, eine Kopfbedeckung zu tragen.
Exkursion ins jüdische St. Pölten
Freitag, 13. Mai 2016
Die jüdische Geschichte der Stadt St. Pölten reicht bis in das Jahr 1306 zurück. Nachdem es im 14. Jahrhundert zu einem "Aufruhr" kam, bei dem Juden ermordet und ihr Besitz geplündert wurde, bestand in den folgenden 500 Jahren in der Stadt keine jüdische Gemeinde. 1782 sprach Josef II ein Toleranzpatent für Wien und NÖ aus, was auch zu einem Anstieg der jüdischen Bevölkerung in St. Pölten führte. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich ein reges Gemeindeleben; St. Pölten hatte seine eigene Kultusgemeinde und ab 1913 eine prachtvolle Synagoge. Diese wurde nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht 1938 schwer beschädigt. Nach aufwändiger Renovierung ist dort seit 1988 das Institut für jüdische Geschichte Österreichs untergebracht, dessen Mitarbeiter Christoph Lind und Philipp Mettauer diese Exkursion gestalten werden.
Die Exkursion umfasst einen Besuch der Synagoge sowie beider Friedhöfe und endet mit dem Besuch des Gasthauses Vinzenz Pauli.
Kopfbedeckung nicht vergessen
Links zum Einlesen:
|http://www.injoest.ac.at/|
|http://www.juden-in-st-poelten.at/|
|http://www.vinzenzpauli.at/|
Anmeldung: bis spätestens 4. Mai 2016 unter |mail: jife@vhs.at| oder 01/89174153000
Treffpunkt vor dem JIFE: 13:45 Uhr
Abfahrt: 14:00 Uhr
Abfahrt aus St. Pölten: 18:30 Uhr
Ankunft in Wien: ca. 20:00 Uhr
Kosten: € 25,- (Verköstigung nicht inkludiert!)
Stadtwanderung jüdisches St. Pölten
Freitag, 29.04.2016 | 17:00 Uhr
Eintritt: Freie Spende!
Von dem einstmals blühenden jüdischen Leben in St. Pölten zeugen heute sichtbar nur noch die ehemalige Synagoge an der Renner-Promenade und die beiden Friedhöfe am Pernerstorfer-Platz und an der Karlstettner Straße. Daneben gibt es aber auch noch die Geschichte dieser Gemeinde zu erzählen, was Christoph Lind und Philipp Mettauer im Rahmen ihrer Stadtwanderung zu unternehmen versuchen.
Treffpunkt 17.00 Uhr, ehemalige Synagoge, Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos, Spenden erbeten. Dauer ca. 2 Stunden.
Eine Kooperation mit der Gastwirtschaft |Vinzenz Pauli|!
Spurlos verschwunden? Die Zwangsarbeitslager für Juden und „Ostarbeiter“ in Viehofen und der Glanzstoff-Fabrik 1942-45
Eine Station des Injoest bei der
Langen Nacht der Forschung
22.4.2016, 17:00-23:00
New Design University
Mariazeller Straße 97a
3100 St. Pölten
Durch den Brief einer ehemaligen Gefangenen wurde bekannt, dass in Viehofen jüdische Familien als Arbeitssklaven zur Traisenregulierung eingesetzt waren. Von 1944 bis 1945 hausten bis zu 180 Menschen in Baracken und Hütten. Auch die Glanzstoff betrieb ein Lager für nichtjüdische Zwangsarbeiter/innen. In dieser Station können Sie anhand von Dokumenten, Fotos und Erinnerungen dieser verdrängten Geschichte nachgehen.
Weitere Informationen finden Sie |hier|!
Synagogen nach 1945
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1, 1020 Wien
11./18/25. Februar/10./17./31. März 2016, jeweils Donnerstag, 18.30 Uhr
Koordination: |mail: Dr. Philipp Mettauer| (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten)
70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs thematisiert die Vortragsreihe unterschiedliche Aspekte der Geschichte und Gegenwart von Synagogen, die im Nationalsozialismus beschädigt und ihrer Gemeinden beraubt wurden, deren Gebäude die Zeit jedoch überstanden haben. Die Frage nach Nutzung oder Abriss leerstehender Synagogenbauten und Zeremonienhallen auf jüdischen Friedhöfen nach 1945 stellt sich im Kontext der jeweiligen Erinnerungsdiskurse. Der Umgang mit den verbleibenden Leerstellen der Gedenkkultur vor Ort wird an verschiedenen Beispielen erörtert, sei es die Restitution und Renovierung, das Entdecken des „jüdischen Erbes“ oder die virtuelle Rekonstruktion, um Teile der (Stadt-)Geschichte wieder ins Bewusstsein zu holen.
Programm
mehr...
11.2.2016
Dr. Christoph Lind und Dr. Philipp Mettauer, (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
„Wer kann den Judentempel brauchen?“ Die ehemalige Synagoge St. Pölten zwischen Novemberpogrom und Renovierung
18.2.2016
Dr. Dieter Hecht, (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Unsichtbare Synagogen? Die Untere Viaduktgasse 13 und die Kaschlgasse 4
25.2.2016
Dr. Robert Streibel, (Volkshochschule Wien Hietzing)
Die dunklen Schatten der Geschichte. Der Abriss der Synagoge Krems 1978
10.3.2016
Dr. Tim Corbett, (Center for Jewish History, New York City)
Der Vernichtung gedenken. Politik und Erinnerung anhand der Zeremonienhallen auf den Wiener jüdischen Friedhöfen.
17.3.2016
Dr. Benjamin Grilj, (Institut für jüdische Geschichte Österreichs): „Cinemagoge“. Der Umgang mit dem jüdischen Erbe von Czernowitz
31.3.2016
Ao. Univ. Prof. Bob Martens (Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien) und Dipl. Ing. Herbert Peter (Artium Architecture und Akademie für Bildende Künste) Virtuelle Synagogen-Rekonstruktionen
...weniger

Kick-off Forschungsnetzwerk Interdisziplinäre Regionalstudien (FIRST)
Montag, 14. März 2016
13:00 Uhr, Seminarraum 3.6 (Altbau, 3. Stock)
Donau-Universität Krems
Begrüßung
Mag. Friedrich Faulhammer
Rektor der Donau-Universität Krems
Einleitende Worte
Mag. Hermann Dikowitsch
Leiter Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Mag. Martina Höllbacher
Leitung Abteilung Wissenschaft und Forschung
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
„FIRST come, FIRST served“ – Geistes-, sozial- und kulturwissenschaftliche
Forschung und Netzwerkmanagement an der Donau-Universität Krems
Univ.-Prof. Dr. Anja Grebe
Leitung Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, Donau-Universität Krems
FIRST: Synergie durch vernetzte Forschung
FIRST, Forschungsverbund Migration und Institut für jüdische Geschichte
Österreichs (St. Pölten)
PD Dr. Martha Keil
FIRST, Forschungsverbund Nahrung und Institut für Geschichte des ländlichen
Raumes (St. Pölten)
PD Dr. Ernst Langthaler
FIRST und Institut für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
(Krems)
Dr. Thomas Kühtreiber
FIRST und Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung
(Außenstelle Raabs/Thaya)
Mag. Philipp Lesiak
Im Anschluss laden wir zu einem kleinen Umtrunk ein!
|Programmfolder|
Da wär’s halt gut, wenn man Englisch könnt. Hermann Leopoldi im amerikanischen Exil
Niederösterreichische Landesbibliothek
Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten
Dienstag, 8. März. 2016, 18 Uhr
Im Rahmen der Ausstellung „Einer, der nicht hassen konnte. Karl Farkas – Emigration und Heimkehr. Dokumente aus dem Literaturarchiv Niederösterreich“ widmet sich der Abend Hermann Leopoldi im amerikanischen Exil.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Landesarchiv, der Landesbibliothek Niederösterreich und dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs
Es sprechen
Mag. Joachim Alscher, Bibliotheksdirektor
Mag. Gabriele Ecker, Leiterin des Literaturarchivs Niederösterreich
Vinzenz Wizlsperger: Gesang, Euphonium
Hannes Loeschel: Piano
Christoph Lind: historische Erzählung
Kuratorinnenführung vor der Veranstaltung um 16.30 Uhr
Anschließend laden wir zu Wein und Brot.
Buchpräsentation „In der Judenstadt”
von Claudia Erdheim
Mit einem einführenden Vortrag von Dr. Martha Keil
24. November 2015, 19 Uhr
Wienbibliothek im Rathaus, Lesesaal
Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse
Stiege 6, 1. Stock, 1010 Wien
Programm
Begrüßung: Alfred Pfoster, Wienbibliothek im Rathaus
Einführung: Martha Keil, Institut für jüdische Geschichte Österreichs
Lesung: Claudia Erdheim, Autorin
Cembalo: René Clemencic
Nächtliche Beleuchtung der Synagoge - Vortrag zur Strafsache Novemberpogrom
10. November 2015, 19 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Am Vormittag des 10. November 1938 verwüsteten die St. Pöltner Nationalsozialisten mit brutaler Gewalt die örtliche Synagoge. Sogar den Davidstern, der von der lebendigen jüdischen Gemeinde der Stadt zeugte, rissen sie von der Kuppel und warfen ihn in die Tiefe. Keine zwei Jahre später war die Gemeinde ausgelöscht. Die Juden der Stadt, hundert Jahre lang ein Teil von ihr, wurden in alle Welt zerstreut oder von den Nationalsozialisten ermordet.
Die Ermittlungen, die ein Jahr nach Kriegsende in St. Pölten durchgeführt wurden, um die Täter dieses 10. November ihrer gerechten Strafe zuzuführen, endeten 1952 in einem Strafprozess vor dem Landesgericht. Trotz umfangreicher polizeilicher Erkenntnisse gab es keine einzige Verurteilung.
Wir wollen dieser Ereignisse gedenken und dazu die Synagoge in der Nacht vom 10. auf den 11. November 2015, vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Anbruch das neuen Tages, hell erleuchten.
Ablauf
mehr...
19.00 Uhr, Programm in der Ehemaligen Synagoge
Christoph Lind, Begrüßung und einführende Worte
Julia Hacker, deren Vater 1938 aus Wien vertrieben wurde und Alexander Kuchar, Schauspieler, lesen die Namen St. Pöltner Jüdinnen und Juden.
Anschließend laden wir zu stillem Gedenken am Stein für die Ermordeten im Garten der Synagoge ein. Kerzen (bitte ohne christliche Symbolik) können gerne mitgebracht und aufgestellt werden.
20.30 Uhr, Gasthaus Vinzenz Pauli
Philipp Mettauer spricht über den Prozess zur St. Pöltner "Kristallnacht" von 1952
In Kooperation mit dem Verein ZSR im Vinzenz Pauli
...weniger

Ari Rath | Begegnungen
Gastvortrag Förderverein Kulturbezirk St. Pölten
Donnerstag, 22.10.2015, 19:00
Begegnungen - Unter diesen Titel stellt der Förderverein Kulturbezirk St. Pölten den Abend mit Ari Rath über sein Leben, seine Arbeit und seine zahllosen Begegnungen mit einflussreichen, oft auch kontroversen Persönlichkeiten erzählen wird. Ari Rath wurde 1925 in Wien geboren und musste im November 1938 emigrieren. Gründungsmitglied des Kibbuz Chamadiya in Palästina. Ab 1958 Redakteur, ab 1975 Chefredakteur und Herausgeber der Jerusalem Post. Er gehört zur Generation von Yitzhak Rabin, Teddy Kollek und Shimon Peres und war Berater von Ben Gurion. 2005 erhielt er das deutsche Bundesverdienstkreuz, 2011 das Große Ehrenzeichen der Republik Österreich.
Moderation
PD Dr. Martha Keil, Institut für jüdische Geschichte Österreichs
Dauer
ca. 1 Stunde 15 Minuten
Im Anschluss Buffet und die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit dem Autor
Anmeldung unter karten@landestheater.net oder T 02742 90 80 80 600
Eintritt
EUR 10,- / für Mitglieder des Förderverein Kulturbezirk St. Pölten kostenlos
mehr...
Mit seinem Buch Ari heißt Löwe, 2012 im Zsolnay-Verlag erschienen, gibt er umfassende, auch sehr persönliche Einblicke in die prägenden Jahre seines Lebens. Der legendäre, in Wien als Sohn galizischer Juden geborene Journalist Ari Rath war oft Zeuge einschneidender Ereignisse in Politik und Zeitgeschichte, die er nun in einem sehr persönlichen Buch aufgeschrieben hat. Er berichtet darin vom „Anschluss“ und der Flucht aus Österreich, vom harten Leben im Kibbuz, von seinen Jahren in den USA im Dienst der zionistischen Jugendbewegung und dem mühsamen Aufbau des Staates Israel. Und er erzählt von seiner Zeitung, der „Jerusalem Post“, bis zum Ende seiner Tätigkeit als Chefredakteur das Sprachrohr eines politisch liberalen Israel, und seinen Begegnungen als Journalist mit Adenauer und Ben-Gurion, Brandt, Schmidt und Sadat.
...weniger
Lange Nacht der Museen
3. Oktober 2015
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Das beeindruckende Jugendstilgebäude mit seinen prächtigen Wandmalereien wurde 1913 eingeweiht, 1938 schwer beschädigt und nach der Renovierung 1984 wiedereröffnet. Da die jüdische Gemeinde St. Pöltens vernichtet wurde, dient die Synagoge nun als Lern- und Gedenkort. Seit 1988 beherbergt sie das Institut für jüdische Geschichte Österreichs. Die wenigen erhaltenen Objekte sowie die Ausstellung „Es gab so nette Leute dort… Die zerstörte jüdische Gemeinde St. Pölten" auf der Frauengalerie vermitteln das Schicksal der jüdischen Gemeinde.
|Bericht| von P3TV zur Langen Nacht der Museen (ab Minute 1:54 zur Ehemaligen Synagoge St. Pölten)
mehr...
Programm
Lesung mit Musik (19.00): „Mich führte in die Wolke“. Briefe und Gedichte von Else Lasker-Schüler (gest. 1945 in Jerusalem), gelesen von Elfriede Irrall, Musik: Helge Stiegler (Flöten).
Vortrag mit Führung (21.00, 22.30): Die Synagoge und ihre Gemeinde (45 Min.)
Präsentation (durchgehend): Schulprojekt zu den Kindertransporten 1938-41
Für Kinder und andere Interessierte: Schreibt Euren Namen auf Hebräisch!
Anmerkung: Eingang barrierefrei, jedoch nicht die WCs!
...weniger

European Researchers’ Night
Jüdische Geschichte stellt aktuelle Fragen
25. September 2015
Aula der Wissenschaften
Wollzeile 27a, 1010 Wien
Wie bewahrt eine Minderheit ihre Identität? Was lässt Migration gelingen, was lässt sie scheitern? Was bedeutet Flucht und Vertreibung für die Betroffenen? Wie geht Österreich mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit um?
Das Institut für jüdische Geschichte Österreichts präsentiert auf der European Researchers' Night seine spannenden Forschungsprojekte, zeigt einen Film von SchülerInnen zum jüdischen St. Pölten und wer möchte, kann seinen Namen auf Hebräisch schreiben.
„Wer kann den Judentempel brauchen?“ Synagogen in Europa nach 1945
25. Internationale Sommerakademie
7.–10. Juli 2015
Ehemalige Synagoge St. Pölten/WU Campus Wien
In Kooperation mit der WU Wien und den Wiener Vorlesungen
Konzept und Organisation: PD Dr. Martha Keil, Dr. Christoph Lind, Dr. Philipp Mettauer
Ehrenschutz: Leslie Bergman, Hans Morgenstern
Einen Bericht zur Sommerakademie finden Sie |hier|.
Die 25. Sommerakademie des Instituts beschäftigt sich 70 Jahre nach Kriegsende mit unterschiedlichen Aspekten von Synagogen in Europa, die im Nationalsozialismus beschädigt und ihrer Gemeinden beraubt wurden, deren Gebäude die Zeit jedoch überstanden haben.
mehr...
Lokale Einzelbeispiele der Nachnutzung werden im jeweiligen historisch-politischen Kontext untersucht, das wären beispielsweise das für Österreich relevante „Bedenkjahr“ oder für Osteuropa die Öffnung der Grenzen 1989. Die Frage nach dem Umgang mit leerstehenden Synagogenbauten wird im Verhältnis zu jüdischer Geschichte und jüdischem Kulturerbe, den jeweiligen nationalen Erinnerungsdiskursen und nicht zuletzt im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Überlegungen gestellt.
In den Fällen von kompletter Zerstörung während der NS-Zeit sind die Entwicklungen, die zu Neubauten führten, wie etwa in Graz, von großem Interesse. Unzählige Synagogen wurden erst nach 1945 abgerissen und endgültig demoliert, wie etwa in Krems 1978. Hier sind einerseits die Motive der Auftraggeber und Akteure, andererseits der Umgang mit den verbliebenen „Leerstellen“ im Kontext der Gedenkkultur vor Ort zu untersuchen. Die virtuellen Rekonstruktionen, die seit den 1990er Jahren an den TU Darmstadt, Braunschweig und Wien hergestellt werden, gehören abschließend ebenso zu diesem Themengebiet.
Referentinnen und Referenten aus ganz Europa beleuchten das Thema aus unterschiedlicher Perspektive. Diskussionen zu aktuellen Fragen und Veränderungen – wie etwa zu jüdischen Migrationsbewegungen innerhalb Europas, Gedenkkultur unter Abwesenheit von Zeitzeugen und dem zunehmenden Antisemitismus in einigen europäischen Ländern – werden die Vorträge ergänzen und vertiefen.
|Programmfolder|
Für die Unterstützung der Sommerakademie danken wir:
- Wien Kultur
- Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des
- NationalsozialismusZukunftsfonds der Republik Österreich
- Jewish Welcome Service
- Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland Kammervorstand
...weniger

Eröffnung der 25. Internationale Sommerakademie
7. Juli 2015
„Wer kann den Judentempel brauchen?“ Synagogen in Europa nach 1945
Ehemalige Synagoge St. Pölten, 19 Uhr
Dr. Karl Renner-Promenade 22, 3100 St. Pölten
mehr...
Begrüßung
PD Dr. Martha Keil, Direktorin des Injoest
Grußworte
Mag. Raimund Fastenbauer, Generalsekretär der IKG Wien
Mag. Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung für Kunst und Kultur des Landes NÖ, in Vertretung von LHM Dr. Erwin Pröll
Mag. Matthias Stadler, Bürgermeister der Stadt St. Pölten
Konzert im Gedenken an Theodor und Anni Schreier
Irene Schreier Scott (Klavier), Enkelin des Architekten der Synagoge Theodor Schreier (1873 Wien–1943 Theresienstadt) mit Tochter Monica Scott (Violoncello) unter Mitwirkung ihrer elfjährigen Enkelin Magali Pelletey (Violine; alle Berkeley, USA)
Eine musikalische Lebensgeschichte
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Andante aus der 1. Sonate für Viola da Gamba und Klavier
Moriz Violin (1882-1956): Zwei Klavierskizzen
Leoš Janáček (1854-1928): Pohádka (Märchen) für Cello und Klavier
Franz Schubert (1797-1828): Impromptu in Ges-Dur für Klavier
Vier Jiddische Volkslieder aus der Sammlung Engel Lund und Ferdinand Rauter (für Cello und Klavier übertragen von Monica Scott)
Fritz Kreisler (1875-1962): „Liebesfreud“ für Violine und Klavier
Joseph Haydn (1732-1809): Finale Vivace aus dem Klaviertrio in D-Moll (Hob. XV:23; 1794/95)
...weniger
a_schaufenster 25: Vertrieben und ignoriert. Drei ArchitektInnenleben
17. Juni 2015
Architekturzentrum Wien – Podium
Museumsplatz 1, 1070 Wien, 18 Uhr
Eintritt frei!
Philipp Mettauer, Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten
Sabine Plakolm, Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege, TU Wien
Andreas Hofer, Institut für Städtebau und Landschaftsarchitektur, TU Wien
Iris Meder, Kunst- und Architekturhistorikerin
Moderation: Monika Platzer, Az W
Wir folgen den Spuren dreier Lebensgeschichten, die durch die nationalsozialistische Herrschaft zwangsweise und radikal verändert wurden.
mehr...
Philipp Mettauer spricht über den Ausschluss jüdischer KollegInnen aus dem Berufsleben, über Flucht und Vertreibung, den schwierigen Neuanfang in der Fremde und die meist nicht erfolgte Rückkehr. Sabine Plakolm erzählt über Liane Zimbler (1892 – 1987), die als erste Frau in Österreich noch im Februar 1938 die Befugnis einer Ziviltechnikerin erhielt, kurz darauf allerdings fliehen musste. Andreas Hofer gibt Einblick in das Leben von Karl Brunner (1887 – 1960), der bereits ab 1929 in Südamerika stadtplanerisch tätig war, seiner 1937 erfolgten Berufung nach Wien als Professor an die Akademie der bildenden Künste aus politischen Gründen nicht mehr nachkommen konnte und erst 1948 nach Österreich zurückgerufen wurde. Iris Meder stellt den Loos-Schüler Josef Berger (1898 – 1989) vor, der bereits 1934 aufgrund der politischen Situation nach Palästina emigrierte und von dort dann 1937 weiter nach London.
...weniger

Steinsetzung am Massengrab der Opfer von Hofamt Priel
3. Mai 2015
Jüdischer Friedhof St. Pölten, Karlstettner Straße 3, 11 Uhr
mehr...
In der Nacht von 2. auf den 3. Mai 1945 ermordeten unbekannte SS-Männer in Hofamt Priel (Ybbs Persenbeug) 228 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter, Männer, Frauen und Kinder. Jakob Schwarcz, damals elf Jahre alt, überlebte das Massaker. 70 Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod erhalten die Ermordeten endliche einen Grabstein mit allen Namen.
Es sprachen
Generalsekretär der IKG Wien, Mag. Raimund Fastenbauer
Ilana Lewin, Tochter von Jakob Schwarcz
Ronni Schwarcz, Sohn von Jakob Schwarcz
Verlesung aller Namen durch
Zweiter Präsident des NÖ Landtages Mag. Johann Heuras in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, Familie Schwarcz und Menschen, die mit diesem Ereignis befasst sind.
El Male Rachamim, gesungen von Oberkantor Shmuel Barzilai
Kaddisch, gesprochen von Jakob Schwarcz
Bitte beachten Sie, dass auf jüdischen Friedhöfen Männern das Tragen einer Kopfbedeckung vorgeschrieben ist.
Wir danken folgenden Institutionen und Personen für ihre Unterstützung:
Kulturabteilung des Landes NÖ
Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
Zukunftsfonds der Republik Österreich
Stadt St. Pölten
Jewish Welcome Service
Österreichisches Schwarzes Kreuz. Kriegsopferfürsorge
Franz Hinterhofer
Marcus Hufnagl
Entwurf des Grabsteins: Renate Stockreiter
...weniger
„Ostjuden“ – Geschichte und Mythos
Buchpräsentation
30. April 2015
mehr...
Hrsg. von Philipp Mettauer und Barbara Staudinger
Schriftenreihe des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs 1. Studienverlag – Innsbruck, Wien, Bozen 2015. ISBN 978-3-7065-5411-4
Donnerstag, 30. April 2014, Wien Museum, 18.30 Uhr
In Kooperation mit dem Wien Museum
Um 1900 veränderte sich die jüdische Welt Mitteleuropas. Pogrome und wirtschaftliche Not hatten zur Folge, dass osteuropäische Juden massenhaft in den Westen migrierten, in Metropolen wie Wien genauso wie nach Amerika. Die in der Mehrzahl religiösen „Ostjuden“ trafen dort auf weitgehend in die nichtjüdische Gesellschaft integrierte „Westjuden“ und damit auf ein völlig neues Umfeld.
Der aus einer Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs entstandene Band nähert sich dem Thema aus unterschiedlichen Sichtweisen: Eine Perspektive führt in den Osten, zu den jüdischen Gemeinden Galiziens. Andere Beiträge setzen sich mit den „Ostjuden“ im Westen auseinander: mit Wien, mit Migration und Menschenhandel, mit Kulturtransfer.
Programm
- Begrüßung: Dr. Wolfgang Kos (Wien Museum), Dr. Martha Keil (Injoest)
- Kurzreferate von Philipp Mettauer, Peter Becker und Barbara Staudinger
- Dazwischen und anschließend: Klezmer Reloaded. Maciej Golebiowski, Klarinetten; Alexander Shevchenko, Bajan (Knopfakkordeon). Das polnisch-russische Duo kam vor 13 Jahren nach Wien, 2008 erschien die erste CD, 2011 folgte das Album „Mahler reloaded“. Inspiriert von Jazz, Folk, Klassik und orientalischen Klängen fanden die Musiker ihren ganz persönlichen Zugang zum ostjüdischen Klezmer.
...weniger
Jüdische Gelehrtenkultur im mittelalterlichen Österreich
Vortrag
29. April 2015
mehr...
von PD Dr. Martha Keil
im Rahmen der Ringvorlesung „Lehrhaus, Akademie, Kanzel und Lehrstuhl“
Mittwoch, 29. April 2015, 17.30-19.30
Institut für Judaistik, Campus der Universität Wien, Hof 7.3
...weniger
Zerbrochene Siegel und wertlose Briefe
Konfliktfelder und Konfliktvermeidung im spätmittelalterlichen Geschäftsverkehr zwischen Juden und Christen
Vortrag
24. März 2015
mehr...
von Dr. Eveline Brugger, MAS, und Dr. Birgit Wied, MAS
Dienstag, 24. März 2015
Universität Graz, Institut für Geschichte
...weniger
Jüdische Kindheit und Jugend ab 1900
Mehrteilige Vortragsreihe
19. Februar – 19. März 2015
mehr...
19.2.: Dr. Robert Streibel, (Volkshochschule in Wien Hietzing, Historiker) „Ein nicht enden wollender Lobgesang mit störenden Zwischenrufen“. Eugenie Schwarzwald und ihre Schule
26.2.: Merethe Jensen M.A. (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten, Historikerin): Die Kindertransporte zur Rettung jüdischer Kinder aus Österreich nach Skandinavien 1938–1940
5.3.: Dr. Wolfgang Gasser, (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten, Historiker): „Das Ende (m)einer Kindheit?“ Wissenschaft und Selbstbezüge – Jugendliche analysieren Video-Interviews zu den Kindertransporten
12.3.: Univ.-Lekt. Mag. Andreas Baumgartner (Das Sozialwissenschaftliche Forschungsbüro, Wien, Sozialforscher & Historiker) „Da war meine Kindheit plötzlich zu Ende...” Kinder als Häftlinge in Konzentrationslagern
19.3.: Dr. Philipp Mettauer, (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten, Historiker): Jüdische Kindheit vor und nach dem „Anschluss“. Erinnerungen in lebensgeschichtlichen Interviews
Die Vorträge behandeln unterschiedliche Aspekte von Kindheit, sowohl innovative Ansätze in der Mädchenbildung und das unbeschwert erinnerte Leben, das mit dem „Anschluss“ schlagartig zerbrach, als auch die Erfahrungen von Verfolgung, Flucht, Vertreibung bzw. Rettung jüdischer Kinder aus Österreich während der Zeit des Nationalsozialismus.
Jeweils Donnerstag, 18.30–20.00 Uhr
Praterstern 1, 1020 Wien
|Weitere Informationen|
...weniger
„Volver“. Von Südamerika zurückgekehrt?
Lebensgeschichtliche Interviews mit österreichisch-jüdischen RemigrantInnen
Vortrag
20. Februar 2015
mehr...
von Philipp Mettauer
im Rahmen des Internationalen Symposiums
„Bilderbuch-Heimkehr? Remigration im Kontext“
veranstaltet vom Institut für Germanistik und der Wienbibliothek
18. – 20. Februar 2015
Wienbibliothek, Adolf-Loos-Räume
|Programm|
...weniger
Von der Opferthese zur europäischen Erinnerungskultur?
Zur Neukonzeption der österreichischen Länderausstellung in Auschwitz-Birkenau
29. Jänner 2015
mehr...
Donnerstag, 29. Jänner 2015, 18.30 Uhr
Diplomatische Akademie Wien
Favoritenstraße 15a, 1040 Wien
Im Jänner 2015 jährt sich zum 70. Mal die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Aus diesem Anlass werden im Rahmen der Reihe „Werkstattgespräche“ das Konzept zur neuen österreichischen Länderausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau und die bisherigen Arbeiten und Rahmenbedingungen des Projektes präsentiert.
|Hier| finden Sie weitere Informationen und das Programm!
|Anmeldung| bis zum 26.1. 2015 erforderlich!
...weniger
Die Banalität des Guten. Feldwebel Anton Schmid
Buchpräsentation, Lesung und Gespräch
11. Dezember 2014
mehr...
19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr
Psychosoziales Zentrum ESRA, 1020 Wien, Tempelgasse 5
Begrüßung
Peter Schwarz, ESRA
Konstantin Kaiser, Theodor Kramer Gesellschaft
Einführende Worte
Martha Keil, Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten
Lesung aus Briefen von Anton Schmid
Maria Harpner
Gespräch
Martha Keil mit Manfred Wieninger
Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.
Für die Veranstaltung bitten wir um Anmeldung unter info(at)esra.at oder Tel. (01) 214 90 14.
Manfred Wieninger erforschte viele Jahre das Leben von Anton Schmid und verarbeitete dessen Briefe, die er aus Litauen an seine Frau und seine Tochter geschrieben hatte, sowie zahlreiche andere Quellen in dem Roman Die Banalität des Guten. Feldwebel Anton Schmid. Roman in Dokumenten, der im Herbst 2014 im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft erschienen ist.
Anton Schmid wurde am 9. Jänner 1900 als Sohn eines Bäckergehilfen und einer Winzertocher in Wien geboren. Als junger Mann lebte er einige Jahre im 2. Bezirk und arbeitete beim Postamt in der Weintraubengasse. 1926 eröffnete er ein Elektro-, Foto- und Radiogeschäft in der Klosterneuburgerstraße, das er zusammen mit seiner Frau führte.
Im August 1939 wurde er zur Wehrmacht einberufen, ab 1941 war er in Wilna/Vilnius im besetzten Litauen stationiert, wo er die Sammelstelle für versprengte Soldaten leitete. An die Sammelstelle angeschlossen waren auch für die Wehrmacht tätige Werkstätten, wo jüdische ZwangsarbeiterInnen arbeiten mussten. Schmid unterstützte sie mit Essen, versteckte immer wieder besonders gefährdete Menschen in seinem Büro und stattete sie mit gefälschten Papieren aus.
Als die Massenerschießungen im Wald von Ponary im Sommer 1941 begannen, wurde er von jüdischen Widerstandsgruppen im Ghetto kontaktiert und um Hilfe gebeten. Schmid begann, Menschen aus dem Ghetto zu retten, indem er jeweils zwischen fünf und dreißig Menschen in einem Wehrmachts-LKW in Gegenden brachte, die noch als sicherer galten, wie etwa das 200 km entfernte Bialystok oder Städte in Weißrussland.
Anton Schmid wurde im Jänner 1942 verraten, verhaftet und durch ein Feldgericht zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am 13. April 1942 in Wilna durch ein Erschießungskommando vollstreckt.
Yad Vashem verlieh ihm im Dezember 1966 posthum die Auszeichnung „Gerechter unter den Völkern“.
...weniger
Lange Nacht der Museen
04. Oktober 2014
mehr...
Samstag, 4. Oktober 2014, 17.00 bis 01.00 Uhr
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
Attraktionen im Innenraum
Einige wenige Objekte, die Verfolgung und Krieg überlebt haben, sowie die Ausstellung „Es gab so nette Leute dort...“ vermitteln das Schicksal der zerstörten jüdischen Gemeinde. Die Lichtskulptur von Peter Daniel beleuchtet Wahrheit und Tod. Der symbolische Toravorhang „Der Neunte Tag“ von Simon Wachsmuth bewegt sich im Wind der Zeit.
Programm
17.00, 19.00, 21.00 Uhr, Vortrag Martha Keil: Die Synagoge und ihre Gemeinde (30 Min.)
Durchgehend
Wolfgang Gasser, Philipp Mettauer, Merethe Jensen: Präsentation des Sparkling-Science-Projekts „Das Ende (m)einer Kindheit? Kindertransporte zur Rettung jüdischer Kinder und Jugendlicher aus Österreich 1938–1941“
Für Kinder und Interessierte
Schreibt Euren Namen auf Hebräisch
Eingang barrierefrei, nicht jedoch die WCs
Eintritt nur für die Synagoge frei, Gesamtticket für die regionalen Museen € 6.–, für alle Museen österreichweit € 13.–, ermäßigt 11.–
...weniger
Die Banalität des Guten. Feldwebel Anton Schmid
von Manfred Wieninger
Buchpräsentation
02. Oktober 2014
mehr...
Donnerstag, 2. Oktober 2014, 19:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
In Zusammenarbeit mit der Theodor Kramer-Gesellschaft
Feldwebel Anton Schmid (19.1.1900 Wien–25.4.1942 Wilna) ist der mutmaßlich einzige von rund 18 Millionen Wehrmachtssoldaten, der wegen „Judenrettung“ von der hitlerdeutschen Militärjustiz zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist.
Zum Autor: Manfred Wieninger, 1963 in St. Pölten geboren, forschte zu Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit und ist Autor der Krimi-Reihe mit dem schrägen Detektiv Marek Miert (Haymon Verlag). 2013 erhielt er den Theodor Kramer-Preis für Schreiben im Widerstand und Exil.
Programm
Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
Begrüßung und einführende Worte
Konstantin Kaiser (Leiter der Theodor Kramer-Gesellschaft, Hg. der Zeitschrift „Zwischenwelt“)
im Gespräch mit Manfred Wieninger
Maria Harpner liest aus dem Buch
Manfred Wieninger: Die Banalität des Guten. Feldwebel Anton Schmid. Wien: Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft 2014. 192 Seiten. Euro 21,–
...weniger
„Der letzte Jude“ – was nun?
01.10.2014,9.00-10.30, Klagenfurt
mehr...
Panel 22: „Der letzte Jude“ – was nun? Aufgaben und Perspektiven zeitgeschichtlicher Forschung in St. Pölten im Rahmen des Zeitgeschichtetages 2014 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Chair: Barbara Staudinger
Christoph Lind, Wollen wir einen Gedenkpark? Das Projekt „Neugestaltung des alten jüdischen Friedhofs St. Pölten“
Philipp Mettauer, Das „Erbe“ der letzten Generation. Familiengedächtnis ohne ZeitzeugInnen
Wolfgang Gasser, „Was gibt es nun zu sagen?“ Vermittlungsstrategien am Lern- und Gedenkort ehemalige Synagoge St. Pölten
...weniger
European Researchers Night
26. September 2014
Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien)
mehr...
Freitag, 26. September 2014, 17.00–24.00 Uhr
Aula der Wissenschaften
Wien 1, Wollzeile 27A
Institut für jüdische Geschichte bei der
European Researcher's Night, F.I.T. for Future
veranstaltet von der FH St. Pölten
An.Denken
Ausstellung zu vertriebenen und ermordeten jüdischen Wissenschafter/innen
Stellvertretend für alle aus unserem Land vertriebenen oder ermordeten jüdischen Wissenschafter/innen werden sieben Forscherinnen und Forscher porträtiert, drei zur Geschichtsforschung und vier zu den Naturwissenschaften. Eine von ihnen, Rosa Kubin, geb. Lustig, stammt aus St. Pölten. Eine ruhige Klanginstallation von Hannes Raffaseder, Komponist und Rektor der FH St. Pölten, begleitet die Porträts.
Projekt- und Filmpräsentation
Sparkling Science-Projekt „Das Ende (m)einer Kindheit? Kindertransporte zur Rettung jüdischer Kinder und Jugendlicher aus Österreich 1938–1941“
...weniger
Das Ende der Kindheit? – Jüdische Kindheit und Jugend ab 1900
Das Ende der Kindheit? – Jüdische Kindheit und Jugend ab 1900
24. Internationale Sommerakademie, Institut für jüdische Geschichte Österreichs
Tagungsort und -termin: 2.-4. Juli 2014, WU Campus, Wien
In Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien und den Wiener Vorlesungen
mehr...
Kindheit, wie wir sie heute verstehen, ist eine Entdeckung der Moderne und eine Errungenschaft des Bürgertums. Auch in den jüdischen Gesellschaften unterliegt sie als soziales Konstrukt einem ständigen kulturellen und historischen Wandel. Die Frage, wann und wodurch Kindheit endet, ist nicht eindeutig zu beantworten.Sowohl im orthodoxen und traditionellen Judentum als auch im säkularen Bürgertum prägte die hohe Wertschätzung von Erziehung und Bildung die pädagogischen Konzepte. Selbst unter den widrigsten Lebensbedingungen wie in den nationalsozialistischen Ghettos und Lagern wurde versucht, die Kinder weiterhin pädagogisch zu betreuen und zu unterrichten.
Das „Ende der Kindheit“, die besondere Betroffenheit der Kinder durch rassistische Verordnungen, Flucht, Vertreibung und Deportation in Ghettos und Konzentrationslager steht zunehmend im Forschungsinteresse. Eine Herausforderung stellt die Vermittlung der Shoah an die mittlerweile „vierte Generation“ dar, die in Vorträgen zur „Holocaust-Education“ und Didaktik an Gedenkstätten diskutiert wird. Referentinnen und Referenten aus Österreich, Deutschland, Dänemark, Polen, Russland, Israel und La Réunion bringen zum Tagungsthema ein breites Spektrum an Perspektiven ein.
Organisation: Wolfgang Gasser, Martha Keil, Philipp Mettauer
Ehrenschutz: Leslie Bergman
|Programm|
...weniger
„Der Neunte Tag“
Gedenkinstallation von Simon Wachsmuth (Berlin) als symbolischer Toravorhang
Sonntag, 4. Mai 2014, 16:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Begrüßung
LR Mag. Barbara Schwarz (i.V. des Landeshauptmanns von Niederösterreich Dr. Erwin Pröll)
BM Mag. Matthias Stadler
Mag. Raimund Fastenbauer (IKG Wien)
Dr. Martha Keil (Injoest)
Es erklingt eine neue Komposition von Konrad Rennert (Wien)
Anschließend kleines Buffet.
Wir danken der Firma WOHMEYER BAU für die Unterstützung des Projekts
...weniger
„Gott und Kaiser“
100 Jahre ehemalige Synagoge St. Pölten
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pölten
Geöffnet Mi-So, 10-17 Uhr, Eintritt 5.-/3.-/2.-
Laufzeit: 14. 11. 2013 - 27. 4. 2014
Kuratiert und gestaltet von Dr. Martha Keil und Mag. Renate Stockreiter
mehr...
Kostenlose Führungen von Dr. Martha Keil:
26. Jänner, 23. Februar, 23. März, 27. April 2014 (jeweils um 15 Uhr)
24. April 2014 (17 Uhr 30)
Donnerstag, 24. 4. 2014, 17:30
Führung durch die Ausstellung
Sonntag, 27.4.2014, 15:00
Letzte Führung durch die Ausstellung
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des |Stadtmuseums St. Pölten|
...weniger
Kleine jüdische Kolonien. Juden in Niederösterreich 1782-1914
von Christoph Lind
Buchpräsentation
Donnerstag, 24. 4. 2014, 19:00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pölten
mehr...
Begrüßung
Mag. Thomas Pulle (Stadtmuseum) und Dr. Martha Keil (Injoest)
Erzählung, Gesang und Harmonien
Dr. Christoph Lind, Dr. Georg Traska, Hannes Löschl, Vincenz Wizlsperger
Anschließend kleines Buffet.
Das Buch ist im Mandelbaum Verlag erschienen
|Weitere Informationen|
...weniger
Gott und Kaiser. 100 Jahre ehemalige Synagoge St. Pölten
Präsentation des Ausstellungskatalog
12. Dezember 2013, 19:00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pölten
Aufhebenswert. Quellen zur Jüdischen Geschichte Niederösterreichs
33. Symposion des NÖ Instituts für Landeskunde gemeinsam mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs zum Jubiläum von 150 Jahren NÖ Landesarchiv, 200 Jahren NÖ Landesbibliothek und 25 Jahren Institut für jüdische Geschichte Österreichs
19. – 20. November 2013
NV-Forum der NÖ Versicherung
Neue Herrengasse 10
3109 St. Pölten
Bitte um Anmeldung von 31. Oktober und 14. November 2013 unter www.aufhebenswert.at
mehr...
Dienstag, 19. November 2013
14:00 Eröffnung
14:30 Eröffnungsvortrag
Martha Keil, Zeugen von Gewalt. Mittelalterliche hebräische Fragmente in niederösterreichischen Bibliotheken
15:15 – 15:45 Kaffeepause
15:45 – 17:15 1. Panel – Mittelalter
Chair: Roman Zehetmayer
Birgit Wiedl, Wer ist Ernustus iudeus? Die schwierige Suche nach Juden in mittelalterlichen Archivbeständen
Eveline Brugger, Daz her Chalhoh von Eberstorf gelten sol Lebmanne dem Juden. Das Urkundenarchiv der Herren von Ebersdorf als Fundgrube für die mittelalterliche
jüdische Geschichte Niederösterreichs
17:30 – 18:30
Spezialführung im NÖ Landesarchiv – Quellen zur jüdischen Geschichte Niederösterreichs
18:30 – 22:00
Abendveranstaltung im NÖ Landesmuseum
Kurzkonzert, Lesung und Empfang
Mittwoch, 20. November 2013
09:30 – 10:50 2. Panel – Frühe Neuzeit
Chair: Martha Keil
Barbara Staudinger, Gebet im Mauthaus, Streit am Marktplatz. Quellen zur jüdischen Geschichte Niederösterreichs in der Frühen Neuzeit
Elisabeth Loinig, Privilegiert – Toleriert – Abgewiesen. Jüdische Bittsteller vor der niederösterreichischen Regierung im 18. Jahrhundert
10:50 – 11:20 Kaffeepause
11:20 – 12:40 3. Panel – 19. und 20. Jahrhundert
Chair: Willibald Rosner
Christoph Lind, Von Kaiser Joseph II. zu Adolf Hitler. Quellen zur jüdischen Geschichte Niederösterreichs 1782-1945
Iris Palenik, Die vergessene „erste“ Migration. Die Einwanderung nach Niederösterreich von 1848 bis 1921 in jüdischen Lebenserinnerungen
12:40 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 15:30 4. Panel – Theater und Literatur
Chair: Elisabeth Loinig
Gertrude Langer-Ostrawsky, Schwer zu sein ein Jud. Drama, Kabarett, Komödie, Operette – Jüdisches Theater unter der Zensur der k.k. n.ö. Statthalterei 1856 – 1926
Philipp Mettauer, Erhebung und Berufsverbot. Die Reichsschrifttumskammer, Landesleitung Österreich, Gruppe Buchhandel
Schlussdiskussion und Ende der Tagung
...weniger
„Gott und Kaiser“
100 Jahre ehemalige Synagoge St. Pölten
Vernissage der Ausstellung
13. November 2013, 19:00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pölten
Klanginstallation
von Hannes Raffaseder zum Gedenken an die in der NS-Zeit ermordeten und vertriebenen jüdischen Wissenschafter/innen, mit 7 Kurzporträts im Rahmen der European Researcher's Night
27. September 2013, 15:00-21:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
Eintritt frei
25 Jahre Injoest
Festveranstaltung
12. September 2013, 19:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Begrüßung
Dir. Dr. Martha Keil
Grußworte
Präsident der IKG Wien Oskar Deutsch
Bürgermeister der Stadt St. Pölten Mag. Matthias Stadler
Sektionschef a.D. HR Dr. Raoul Kneucker als Vertreter des BMWF
Vertreter des Landeshauptmanns des Landes NÖ Dr. Erwin Pröll
Festrede
„25 Jahre Institut für jüdische Geschichte Österreichs“
Em. Univ. prof. Dr. Karl Brunner
Kurzvorträge
„Jüdische Geschichte aktuell“
Dr. Martha Keil, Dr. Barbara Staudinger, Dr. Philipp Mettauer
Musik
Auturja Trio
Buffet
Getränke und Bötchen
...weniger
Drei Generationen – Shoa und Nationalsozialismus im Familiengedächtnis
23. Internationale Sommerakademie
3.-5. Juli 2013
Veranstaltungszentrum Erste Bank
Petersplatz 7
Wien 1
mehr...
Für die Vertriebenen und Überlebenden der Shoah war die Geburt ihrer Kinder ein zentrales Ereignis im Nachkriegsleben, sie waren Sinngeber für den Neuanfang. Die elterlichen Aufträge und Erwartungen an die Kinder waren dabei umfassend. Sie sollten eine Brücke zum Leben und ein Symbol des Sieges über die Verfolger sein, die traumatischen Erlebnisse annullieren, die Ermordeten ersetzen. Die Zählung begann von neuem, die ZeitzeugInnen des Nationalsozialismus wurden zur „ersten Generation“.
Neben elterlicher Freude und Zuwendung konnten sich aber vielfältige Belastungen und Einschränkungen für die Nachkommen entwickeln, wobei es nahezu unmöglich erscheint, die Auswirkungen der Verfolgung auf einen Nenner zu bringen. Neben den Gefühlen der Verunsicherung und der Entwurzelung, des niemals Ankommens, der „ewigen Emigration“ prägt vor allem der Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung die Forschungsliteratur über transgenerationale Spätfolgen.
In der „Tätergesellschaft“ bewirkte die Auseinandersetzung mit der Elterngeneration die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Tradierung nationalsozialistischer Ideologie sowie Schuld- und Schamgefühlen in Familien ehemaliger NS-AnhängerInnen. Die Weitergabe an die dritte Generation scheint für beide Gruppen weitgehend unerforscht.
Die Tagung nähert sich der Problematik aus historischen, psychologischen und literarischen Perspektiven.
Organisation: Dr. Martha Keil, Dr. Philipp Mettauer
|Programm|
Wir danken der Erste Bank für die Unterstützung unserer Veranstaltung
...weniger
Kleine jüdische Kolonien. Juden in Niederösterreich 1782–1914
von Christoph Lind
Buchpräsentation
Montag, 17. Juni 2013, 19:00
Looshaus, Souterrain
Michaelerplatz 3
1010 Wien
mehr...
Programm
Begrüßung
Martha Keil, INJOEST
Michael Baiculescu, Mandelbaumverlag
„Es sei gestattet, die Aufmerksamkeit der Leser und namentlich unsererGroßgemeinde zu Wien auf die kleinen jüdischen Kolonien hinzulenken,die sich im Erzherzogtume unter der Enns seit 1849 angesiedelt haben,wie sich Inseln in der Nähe größerer Kontinente bilden.“ Die Neuzeit vom 20. Dezember 1861.
Christoph Lind erzählt gemeinsam mit Hannes Löschel (Harmonium) und Georg Traska (Gesang, Lesung) einen Teil der Geschichte dieser „Inseln“.
Danach bitten wir zu einem Glas Wein.
...weniger
Geschichte der Juden in Österreich
von Eveline Brugger, Martha Keil, Albert Lichtblau, Christoph Lind und Barbara Staudinger
Buchpräsentation der unveränderten Neuauflage
14.5.2013, 19.00
Lesesaal Wienbibliothek im Rathaus
Eingang Lichtenfelsgasse, Stiege 6 (Glaslift), 1. Stock
1010 Wien
mehr...
Herwig Wolfram zur Neuauflage der „Geschichte der Juden in Österreich"
Kurzporträts
Jüdische VertreterInnen ihrer Epoche
von Eveline Brugger, Martha Keil, Christoph Lind, Albert Lichtblau
Musikalische Begleitung
Hemma Geitzenauer, Franziska Zöberl (Renaissance- und Barockblockflöten)mit Flötenstücken jüdischer Komponisten aus vier Jahrhunderten
...weniger
Sag mir wo die Juden sind
Erinnerung an St. Pöltens vergessene Gemeinde
Filmpremiere und Diskussion
19. März 2013, 20:00
Cinema Paradiso
Rathausplatz
St. Pölten
Eintritt frei
mehr...
Im März 1938, vor genau 75 Jahren, zog Adolf Hitler von einer Volksmenge umjubelt durch die Straßen St. Pöltens. Ein Privatfilmer hielt diesen Moment fest. Zu sehen sind diese historischen Szenen nun in einem Dokumentarfilm von SchülerInnen des Gymnasiums Josefstraße. Sie haben einen Film gestaltet, der die vergessene jüdische Gemeinde ins Gedächtnis der Stadt zurückholen soll. Ergänzt werden die Originalaufnahmen mit Interviews, in denen die Auswirkungen von Anschluss und Shoah auf die jüdische Gemeinde St. Pölten deutlich werden. Zeitzeugen aus Österreich und Israel, die ihre Wurzeln in der jüdischen Gemeinde St. Pölten haben, sowie BewohnerInnen eines St. Pöltner Seniorenwohnheims erzählen ihre Erinnerungen an den März 1938. „Sag mir, wo die Juden sind“ zeigt den Verlust jüdischer Lebenswelten in St. Pölten. Der Film entstand im Rahmen eines Sparkling-Science-Projekts, einer Initiative des BMWF, in Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs.
Filmpremiere „Sag mir wo die Juden sind. Erinnerung an St. Pöltens vergessene Gemeinde" Ö 2012, Regie/Sprecherin: Lisa Maria BraitnerTechnik, Ton, Kamera, Interviewer, Schnitt: Simon Hayden und Michael KandlerDrehbuch: Lisa Maria Braitner, Simon Hayden und Michael Kandler
Anschließend Diskussion mit Wolfgang Gasser (Moderation), Christoph Lind (Historiker), Iris Palenik (Historikerin), Simon Hayden (projektbeteiligter Schüler), Marie-Noelle Yazdanpanah (Filmhistorikerin)
...weniger
Juden und Geheimnis
Vortragsreihe Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1, 1020 Wien
Jeweils Donnerstag um 18:30
Die Vorträge behandeln tatsächliche oder angebliche „jüdische Geheimnisse“ in unterschiedlichen Bereichen von der rabbinischen Zeit bis zur Gegenwart.
Koordination: PD Dr. Martha Keil (INJOEST)
mehr...
21.2.2013
Univ. Prof. Dr. Gerhard Langer (Institut für Judaistik der Univ. Wien)
„Wissen und Macht: Aspekte des Geheimnisses in der rabbinischen Literatur“
28.2.2013
Dr. Barbara Staudinger (INJOEST)
„Das Geheimnis des „Juden“ Philipp Lang von Langenfels (1555-1610)“
7.3.2013
Dr. Philipp Mettauer (INJOEST)
„Die Großen die flüstern dann, weil die Kinder sollen nicht hören.“
Geheimnisse verfolgter Familien im Nationalsozialismus.
14.3. 2013
PD Dr. Martha Keil (INJOEST)
„Geheimes in spätmittelalterlichen hebräischen Geschäftsurkunden“
...weniger
Eine bedeutende Minderheit
Juden in der österreichischen Geschichte
Vortrag von Dr. Martha Keil
Dienstag, 22.1.2013, 19:00
Bezirksamt Wien Währing Wien 18
Martinstraße 100/Ecke Währinger Straße (Straßenbahn 40, 41, Station Martinstraße)
„Avigdor, Benesch, Gitl“ – Juden in Böhmen und Mähren im Mittelalter
Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt)
Internationale Konferenz
Brno/Brünn, 27.–29. November 2012
Mährische Landesbibliothek Brünn (|Lageplan|)
Kounicova 65a
601 87 Brno
mehr...
Samuel Steinherz ist heute ein weitgehend vergessener Historiker, der vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre bedeutende Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte veröffentlichte. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich wissenschaftlich wie organisatorisch der Erforschung der Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Einem breiteren Publikum wurde er durch die so genannte „Steinherz-Affäre" bekannt, nachdem er, bereits lange Jahre Professor an der Deutschen Universität in Prag, 1922 zu deren Rektor gewählt wurde. Als Jude verzichtete er nicht, wie zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie üblich, auf die Übernahme dieses Amtes, was zu lautstarken Protesten bis hin zum Streik seitens der deutsch-nationalen antisemitischen Studentenschaft führte. 1942 wurde Steinherz nach Theresienstadt deportiert und dort zu Tode gebracht.
Zum 155. Geburtstag und 70. Todestag von Samuel Steinherz soll diese Konferenz sowohl dessen Leben und Werk wieder deutlicher ins Bewusstsein rücken als auch neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien vermitteln. Die Vorträge behandeln die rechtliche, wirtschaftliche und soziale Lage der jüdischen Gemeinden, Fragen des religiösen Lebens sowie die Pogrome und Vertreibungen im 14. und 15. Jahrhundert. Christlich-jüdische Kontakte sowie Migrationsbewegungen in die Nachbarländer stehen ebenfalls im Fokus.
EhrenschutzJ. E. Detlef Lingemann, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR /
S. E. Dieter Lingemann, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der ČR
J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR /
S. E. Ferdinand Trauttmansdorff, Botschafter der Republik Österreich in der ČR
Michal Hašek, Hejtman Jihomoravského kraje /
Michal Hašek, Hauptmann des Südmährischen Kreises
Konzeption und Organisation
Gesellschaft für Geschichte der Juden in der ČR
Historisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik
Institut für jüdische Geschichte Österreichs
Organisatorische Mitarbeit
Jüdisches Museum in Prag
Samuel-Steinherz-Stiftung, Nürnberg
Programm
DIENSTAG, 27. NOVEMBER
10.20-11.00
Eröffnungsvortrag:
Michael Toch (Jerusalem): Wo steht die Erforschung mittelalterlicher jüdischer Existenz in Mitteleuropa?
Referate
11.10-11.50
Winfried Irgang (Weimar an der Lahn): Historiographie der Forschungen zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen Schlesien
11.50-12.30
Alexander Koller (Roma): Samuel Steinherz als Erforscher und Editor päpstlicher Nuntiaturberichte
14.00-14.40
Jörg Müller (Trier): König Johann und die Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien
14.40-15.20
Eveline Brugger (St. Pölten): Grenzüberschreitung und Grenzziehung. Judenpolitik zwischen Österreich, Böhmen und Mähren im Hoch- und Spätmittelalter
15.50-16.30
Martha Keil (St. Pölten): Erfolgsgeschichten. Die jüdische Einwanderung aus Böhmen und Mähren in die österreichischen Länder im Spätmittelalter
16.30-17.10
Birgit Wiedl (St. Pölten): Die Auswirkungen der angeblichen Hostienschändung in Pulkau (1338) auf Böhmen und Mähren
MITTWOCH, 28. NOVEMBER
9.15-9.55
Eva Doležalová (Prag): Pogromy v zemích Koruny české za vlády Lucemburk? (Pogrome in den Ländern der Böhmischen Krone während der Regierung der Luxemburger)
9.55-10.35
Evina Steinová (Haag): Passio Iudeorum Pragensium: Fakta a fikce o pogromu v roce 1389 (Passio Iudeorum Pragensium: Fakten und Fiktionen über das Pogrom im Jahr 1389)
10.55-11.35
Petr Elbel (Brünn), Wolfram Ziegler (Wien): Die Wiener Gesera. Neue Überlegungen zu einem alten Forschungsproblem
11.35-12.15
Pavel Kocman (Brünn): Vypovězení židů z moravských královských měst 1426-1514: Průběh, příčiny, důsledky (Die Ausweisung der Juden aus den mährischen königlichen Städten 1426-1514: Verlauf, Ursachen, Folgen)
14.00-14.40
Lenka Blechová (Prag): Instituce "iudex Iudaeorum" ve středověkých pramenech české provenience (Die Institution „iudex Iudeorum" in mittelalterlichen Quellen böhmischer Provenienz)
14.40-15.20
Libor Jan (Brünn): K nejstarším dokladům úvěrového obchodu členů židovské komunity v Čechách a na Moravě (Zu den ältesten Belegen für Kredithandel von Mitgliedern der jüdischen Kommunität in Böhmen und Mähren)
15.40-16.20
Tamás Visi (Olmütz): Židovské liturgické tradice st?edov?ké Moravy (Jüdische liturgische Traditionen im mittelalterlichen Mähren)
16.20-17.00
Daniel Polakovič (Prag): Knižní kultura českých a moravských židů ve středověku (Buchkultur böhmischer und mährischer Juden im Mittelalter)
17.00-17.40
Rafał Witkowski (Posen): Die jüdische Gemeinde im spätmittelalterlichen Liegnitz. Eine Episode von jüdisch- christlichen Kontakten
DONNERSTAG, 29. NOVEMBER
Themenblock: Samuel Steinherz – Leben und Werk
9.15-9.55
Heidemarie Petersen (Leipzig): Der Stellenwert der Mediävistik in der jüdischen Historiographie des frühen 20. Jahrhunderts. Samuel Steinherz und seine Zeitgenossen
9.55-10.35
Robert Luft (München): Samuel Steinherz und die wissenschaftlichen Institutionen in den böhmischen Ländern
10.35-11.15
Zdeňka Stoklásková (Brünn): Samuel Steinherz und Bertold Bretholz
12.00-12.40
Helmut Teufel (Großostheim): Samuel Steinherz und die Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik
12.40-13.20
Jörg Osterloh (Frankfurt am Main): „... gegen den jüdischen Rektor Steinherz". Antisemitische Proteste an der Deutschen Universität Prag 1922/23
13.20-14.00
Gerhard Oberkofler (Innsbruck): Käthe Spiegel aus Prag. Aus dem Leben einer jüdischen Historikerin aus der Schule von Samuel Steinherz
...weniger
Juden in St. Pölten. Memorbuch
Präsentation der Website
Freitag, 9. November 2012, 18.30
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pöltne
mehr...
Anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome 1938 stellen wir unser virtuelles Memorbuch für die vernichtete St. Pöltner jüdische Gemeinde vor. Die deutsche Version der Website ist ab 10. 11. |online|, die englische Version folgt im Jänner 2013.
Programm
Begrüßung
Dir. Mag. Thomas Pulle (Stadtmuseum)
Zum Inhalt
Dir. PD Dr. Martha Keil (INJOEST)
Zur Gestaltung
Mag. Renate Stockreiter
Aus Lebenserinnerungen lesen
Renate Stockreiter und Giuseppe Rizzo
Musikalischer Rahmen
Mag. Ronald Bergmayr und Schüler/innen des BRG/BORG Schulring
Für die Unterstützung danken wir dem Land Niederösterreich, dem Zukunftsfonds der Republik Österreich und dem Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus.
...weniger
Die andere Seite der Erinnerung?
Prozesse kulturellen Vergessens im jüdischen Kontext
2. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Jüdische Studien in Österreich
7.–8. November 2012
Graz Museum
|Programm|
Jüdische Geschichte
Sektion 20 am 26. Österreichischen Historikertag
Mittwoch, 26. September 2012
Arte Hotel Krems, Seminarraum
9.00 - 12.00
Vorsitz: Eveline BRUGGER
mehr...
Birgit WIEDL, Der Alltag im Geschäft. Aspekte jüdisch-christlichen Zusammenlebens im Spiegel der mittelalterlichen Geschäftsurkunden.
Svjatoslav PACHOLKIV, Jüdisches Leben im ostgalizischen Völkerdreieck 1860-1939.
Wolfgang GASSER, Das Sammeln und Bearbeiten historischer Dokumente durch das Gauamt für Sippenforschung - Quellen zur jüdischen Geschichte oder NS-Rassenwahn?
Iris PALENIK, Zeugen, Wucherer, Christusmörder - ambivalente Bilder des Jüdischen in deutschen Predigten von Wiener Theologen am Beginn des 15. Jahrhunderts.
|Programm|
...weniger
Sag mir, wo die Juden sind
Zum Beispiel St. Pölten: Migration und Gegenwart. Vertreibung und Gedächtnis
Abschlusstagung des Sparkling Science-Projekts
Mittwoch, 19. September 2012
mehr...
16.00 - 19.00
Präsentation der wissenschaftlichen Ergebnisse der Schüler/innen des BG/BRG Josefstraße und BRG/BORG Schulring und der projektbeteiligten Wissenschaftler/innen
Kleines Buffet
Premiere des im Rahmen des Projekts entstandenen Dokumentarfilms
19.00
Konzert mit "Klezmer Reloaded"
|Einladung|
...weniger
Juden und Geheimnis
Verborgenes Wissen und Verschwörungstheorien
22. Internationale Sommerakademie
4.-6. Juli 2012
Veranstaltungszentrum Erste Bank
Petersplatz 7
Wien 1
mehr...
Das Geheimnis verbindet die Eingeweihten und grenzt sie von den Außenstehenden ab. Gesellschaften und soziale Gruppen besitzen nicht nur selbst geheimes Wissen, sondern vermuten auch Geheimnisse beim jeweils anderen. Geheime Schriften und Sprachen, Lehren und Missionen konstituieren daher die Gesellschaft nach außen wie innen. Unabhängig vom Inhalt ist der Austausch von Geheimnissen soziale Interaktion.
Die nichtjüdische Umwelt sah Juden als die Geheimnisträger schlechthin: Zum einen gibt es in der jüdischen Tradition Geheimlehren wie die Kabbala, deren Verbreitung auf wenige Befugte beschränkt war. Zum anderen war das Wissen jüdischer Ärzte gefragt und die Alchemie galt als Geheimwissenschaft, an deren Verbreitung Juden maßgeblich beteiligt waren. Im antijüdischen Kontext vermutete man bei Juden magische Praktiken und der Talmud stand im Verdacht, ein christenfeindliches Geheimwerk zu sein. Ein weiteres, die Jahrhunderte überdauerndes Stereotyp ist die Mitgliedschaft von Juden in Geheimbünden wie der Freimaurerei.
Die Tagung diskutiert das Themenfeld sowohl aus der innerjüdischen Perspektive als auch aus der Wahrnehmung von außen. Einige Vorträge werden sich mit antisemitischen Konstruktionen von Verschwörungstheorien beschäftigen – bis heute aktuelle Themen mit großer medialer Präsenz.
In Kooperation mit dem Institut für Judaistik der Universität Wien und den Wiener Vorlesungen
Veranstaltet mit Unterstützung der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien
Wir danken der Erste Bank für die Unterstützung unserer Veranstaltung
|Programm|
|Tagungsbericht|
...weniger
„Ostjuden“ – Geschichte und Mythos
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
Jeweils Dienstag 18.30
Die Vortragsreihe behandelt den ambivalenten Begriff „Ostjuden“ in seinem historischen Kontext, die Stadt Brody als komplexen Schauplatz galizisch-jüdischer Kultur und zwei Hauptziele der Migration mit ihren Erfolgsgeschichten und Schattenseiten.
Organisation: PD Dr. Martha Keil (INJOEST)
mehr...
21.2.: Dr. Sviatoslav Pacholkiv (INJOEST)
„Ostjuden“: Selbstverständnis und antisemitisches Klischee
28.2.: Dr. Börries Kuzmany (Doktoratskolleg Galizien)
Das galizische Brody – zwischen jüdischer Großstadt und Schtetl
6.3.: Dr. Martha Keil (INJOEST)
Halunken und verlassene Frauen. Die Schattenseite der ostjüdischen Migration in die USA
13.3.: Dr. Barbara Staudinger (INJOEST)
Galizische Juden in Wien: Zwischen Hoffnung, Wohlfahrt und Antisemitismus
...weniger
Besitz, Geschäft und Frauenrechte
Jüdische und christliche Frauen in Dalmatien und Prag 1300-1600
Herausgegeben von Martha Keil. Solivagus Verlag Kiel 2011
Buchpräsentation
in Kooperation mit dem Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖAW
Dienstag, 17. Jänner 2012, 19:00
Österr. Akademie der Wissenschaften, Clubraum
Dr. Ignaz-Seiplplatz 2
Wien 1
mehr...
Mark Hengerer (Hg.), Tradition und Entfremdung. Die Lebenserinnerungen des jüdischen Privatdozenten Max Ungar (1850-1930) (Reihe Spuren in der Zeit des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Band 6), Studien Verlag, Innsbruck-Bozen-Wien 2011.
Es sprechen
Dr. Heidemarie Uhl (ÖAW)
Dr. Stefan Eick (Solivagus Verlag)
Dr. Martha Keil (INJOEST)
Dr. Mark Hengerer (Universität Brünn/Brno)
Musikalische Umrahmung
Hemma Geitzenauer,
MAMag. Franziska Zöberl (Renaissanceblockflöten)
Ausklang mit Wein und Knabbereien
...weniger
Die Wiener Gesera von 1421
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
Die Geschichte der Juden im 15. Jahrhundert war in ganz Europa von Verfolgung und Vertreibung gekennzeichnet. Mit dem Niedergang der jüdischen Darlehensgeschäfte übten die Herrscher den Judenschutz nur noch nachlässig aus. In politischen Konflikten gerieten jüdische Gemeinden öfter zwischen die Interessensgruppen. Traktate und Predigten von Theologen und Priestern heizten allgemein die judenfeindliche Stimmung an. Die Wiener Judenstadt endete allerdings auf besonders grausame Weise: 210 jüdische Männer und Frauen wurden auf der Erdberger Lände verbrannt, weil sie die Taufe verweigerten, 800 Arme wurden vertrieben, die Synagoge geschleift. Dieser Justizmord ging als „Wiener Gesera“, als „katastrophales Verhängnis“ in die jüdische Geschichtsschreibung ein.
mehr...
5. Oktober 2011, 18:30
Klaus Lohrmann (Univ. Wien)
Die Päpste des Mittelalters und die Juden
11. Oktober 2011, 18:30
Birgit Wiedl (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
Der Vorwurf der Hostienschändung an die Juden
25. Oktober 2011, 18:30
Karl-Heinz Steinmetz (Univ. Wien)
Die Haltung der mittelalterlichen Theologie gegenüber den Juden und die Rolle der theologischen Fakultät in Wien
8. November 2011, 18 Uhr 30
Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
Die Wiener Gesera: politische Rahmenbedingungen, Ereignisse, Zeugnisse
Koordination: Markus Himmelbauer
In Kooperation mit dem Koordinierungsausschuss für christlich-jüdischje Zusammenarbeit
Gefördert von der AK Wien
...weniger
Das Judentum
1. Seminar der Akademie der Religionen
Samstag, 5. 11. 2011
10.00 Uhr: Führung durch die ehemalige Synagoge mit PD Dr. Martha Keil (Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs)
Ehemalige Synagoge in St. Pölten, (Eingang: Lederergasse 12)
mehr...
11.00 Uhr: Dr. Martha Keil Vortrag „FremdVertraut. Das österreichische Judentum in kulturhistorischer Perspektive“, anschl. Diskussion
„Florian Zimmel Saal“, Zentrum der pastoralen Dienste der Diözese St. Pölten, Klostergasse 15, St. Pölten
13.00 Uhr: Mittagessen Bildungshaus St. Hippolyt
14.15 Uhr: Dr. Christoph Lind (Institut für jüdische Geschichte Österreichs) Vortrag „Geschichte des Judentums in Niederösterreich“, Gespräch
Veranstaltet vom Zentrum Religion und Globalisierung/Donau-Universität Krems in Kooperation mit dem Bildungshaus St. Hippolyt und dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs
GEDENKEN AN DIE NOVEMBERPOGROME 1938
Samstag, 5. November 2011, 16:00 (pünktlich)
Zeremonienhalle des Jüdischen Friedhofs St. Pölten
Karlstettner Straße 3 (es besteht auch ein Zugang durch den Hauptfriedhof)
Heuer findet unser alljährliches Gedenken an die Novemberpogrome im Rahmen des Studientages „Judentum“ der Akademie der Religionen an der Donau-Universität Krems, Zentrum Religion und Globalisierung, statt.
Wir werden der jüdischen Gemeindemitglieder gedenken, die sich um die Gründung des Friedhofs verdient gemacht haben. Anschließend besteht die Möglichkeit, am Massengrab der 223 im Mai 1945 in Hofamt Priel ermordeten ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter/innen Kerzen anzuzünden (wer möchte, bitte Grablichter ohne Kreuze mitbringen).
Männliche Teilnehmer werden ersucht, eine Kopfbedeckung zu tragen.
Ende: ca. 17.00 Uhr
|Programm|
...weniger
Von Dreideln, Mazzes und Beschneidungsmessern
Jüdische Dinge im Museum
21. Juni - 16. Oktober 2011, Di – So 10:00 –17:00
Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15–19
1080 Wien
www.volkskundemuseum.at
mehr...
Ein Projekt mit Studierenden der Lehrveranstaltung „Jüdisches im Museum - Sammeln und Ausstellen 1900-2011" unter der Leitung von Birgit Johler und Barbara Staudinger. Eine Zusammenarbeit der Universität Wien, des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs und des Österreichischen Museums für Volkskunde
„Jüdische Dinge" oder „Judaica" sind nicht nur in Jüdischen Museen zu finden. Auch das Österreichische Museum für Volkskunde beherbergt eine solche Sammlung, die bis 1938 in den Schauräumen des Museums ausgestellt war. Nach dem „Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich wurde sie abgeräumt, magaziniert und vergessen.
Heute, 73 Jahre nach der Schoa, wurden 20 Objekte aus diesem Fundus durch TeilnehmerInnen eines Seminars am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien bearbeitet. Ergebnis ist eine Ausstellung, die von Birgit Johler und Barbara Staudinger gemeinsam mit den Studierenden konzipert wurde und die sich mit jüdischen Dingwelten und mit den Sammlungsgeschichten bzw. der musealen Praxis auseinandersetzt. Die „Jüdischen Dinge" sind Dinge ohne Erinnerung - vielfach existieren nur spärliche Informationen im Inventarbuch. Trotzdem sind sie „Zeitzeugen" bzw. Informationsträger: Sie wurden nach ihren verschieden gelagerten Kontexten und Geschichten befragt, dazu gehören auch Fragen im Zusammenhang mit Raub bzw. bedenklichen Erwerbungen. Gefragt wurde aber auch nach stereotypen Bildern oder musealen Zuschreibungen in Vergangenheit und Gegenwart.
Die Ausstellung mit Werkstattcharakter ist keine Ausstellung zu jüdischen Festen, im Rahmen derer viele der ausgestellten Ritualgegenstände verwendet wurden. Vielmehr präsentiert sie eine bestehende Sammlung „jüdischer Dinge", deren Geschichten, kleine Ausschnitte jüdischer Lebenswelten, es zu erzählen gilt.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
...weniger
Festakt und Fotoausstellung
Schülerprojekt Sparkling Science und „Jerusalem from the air"
Mittwoch, 7. September 2011, 18 Uhr 30
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Begrüßungsworte
Institutsdirektorin Dr. Martha Keil
Landesrat Mag. Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll
Grußworte des Bürgermeisters der Stadt St. Pölten
„Jerusalem from the air"
Eröffnung der Ausstellungdurch den Botschafter des Staates Israel, Aviv Shir-On
Jerusalem aus der Vogelperspektive - stimmungsvolle Fotografien: Viele Stätten, die den drei monotheistischen Weltreligionen heilig sind, befinden sich in der Altstadt von Jerusalem, z.B. die Grabeskirche, die Erlöserkirche, der Felsendom sowie die Al-Aksa-Moschee.
In Zusammenarbeit mit der Botschaft des Staates Israel.
Festakt zum Schülerprojekt Sparkling Science
"Projektpräsentation und Urkundenverleihung an die beteiligten Schüler/innen des BRG/BORG St. Pölten durch den INOEST-Mitarbeiter Dr. Wolfgang Gasser
Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von einer Instrumentalgruppe des BRG/BORG St. Pölten unter der Leitung von Mag. Ronald Bergmayr.
|Programm|
...weniger
„Ostjuden“ – Geschichte und Mythos
21. Internationale Sommerakademie
6.-8. Juli 2011
Veranstaltungszentrum Erste Bank
Petersplatz 7
Wien 1
|Programm|
mehr...
In Kooperation mit: Wiener Vorlesungen, Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, Wien Kultur, Erste Bank, Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden
...weniger
Von Dreideln, Mazzes und Beschneidungsmessern
Jüdische Dinge im Museum
Ausstellungseröffnung
21. Juni 2011, 18.00
Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15–19
1080 Wien
Begrüßung
Margot Schindler, Österreichisches Museum für Volkskunde
Brigitta Schmidt-Lauber,Institut für Europäische Ethnologie, Universität Wien
Zur Ausstellung
Birgit Johler, Österreichisches Museum für Volkskunde
Barbara Staudinger, Institut für jüdische Geschichte Österreichs
TeilnehmerInnen des Seminars „Jüdisches im Museum. Sammeln und Ausstellen 1900–2011“, Universität Wien
mehr...
Ausstellungsdauer 21. Juni - 16. Oktober 2011
Di – So 10:00 –17:00
|Österreichisches Museum für Volkskunde|
Laudongasse 15–19
1080 Wien
Ein Projekt mit Studierenden der Lehrveranstaltung „Jüdisches im Museum - Sammeln und Ausstellen 1900-2011" unter der Leitung von Birgit Johler und Barbara Staudinger. Eine Zusammenarbeit der Universität Wien, des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs und des Österreichischen Museums für Volkskunde
„Jüdische Dinge" oder „Judaica" sind nicht nur in Jüdischen Museen zu finden. Auch das Österreichische Museum für Volkskunde beherbergt eine solche Sammlung, die bis 1938 in den Schauräumen des Museums ausgestellt war. Nach dem „Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich wurde sie abgeräumt, magaziniert und vergessen.
Heute, 73 Jahre nach der Schoa, wurden 20 Objekte aus diesem Fundus durch TeilnehmerInnen eines Seminars am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien bearbeitet. Ergebnis ist eine Ausstellung, die von Birgit Johler und Barbara Staudinger gemeinsam mit den Studierenden konzipert wurde und die sich mit jüdischen Dingwelten und mit den Sammlungsgeschichten bzw. der musealen Praxis auseinandersetzt. Die „Jüdischen Dinge" sind Dinge ohne Erinnerung - vielfach existieren nur spärliche Informationen im Inventarbuch. Trotzdem sind sie „Zeitzeugen" bzw. Informationsträger: Sie wurden nach ihren verschieden gelagerten Kontexten und Geschichten befragt, dazu gehören auch Fragen im Zusammenhang mit Raub bzw. bedenklichen Erwerbungen. Gefragt wurde aber auch nach stereotypen Bildern oder musealen Zuschreibungen in Vergangenheit und Gegenwart.
Die Ausstellung mit Werkstattcharakter ist keine Ausstellung zu jüdischen Festen, im Rahmen derer viele der ausgestellten Ritualgegenstände verwendet wurden. Vielmehr präsentiert sie eine bestehende Sammlung "jüdischer Dinge", deren Geschichten, kleine Ausschnitte jüdischer Lebenswelten, es zu erzählen gilt.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.
|Einladung|
...weniger
Juden und Geld im Mittelalter
Vortragsreihe
am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
mehr...
8.3.2011, 18:30
Zins, Geld und Moral in Bibel und Midrasch
Univ. Prof. Dr. Gerhard Langer (Institut für Judaistik der Univ. Wien)
15.3.2011, 18:30
Zinsen, Steuern, Pleiten: Finanzen in jüdischen Quellen
PD Dr. Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten)
22.3.2011, 18:30
Tötbrief und Schuldentilgung - der Einfluss fürstlicher Machtpolitik auf das jüdische Geldgeschäft
Dr. Eveline Brugger, MAS (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten)
29.3.2011, 18:30
Die Kriegskassen voll jüdischem Geld? Die Bedeutung jüdischer Geldgeber für die Kriegsfinanzierung der Habsburger
Dr. Birgit Wiedl, MAS (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten)
...weniger
Taufe oder Tod?
Die Vernichtung der Wiener Judenstadt 1420/21 im Spannungsfeld zwischen Theologie und Politik
Tagung
Do. 10. März 2011, 10:00 - 18:00
Fr. 11. März 2011, 10:00 - 14:00
Fakultätssitzungssaal der Kathol.-theolog. Fakultät Universität Wien, Hauptgebäude, Stiege 8, 2. Stock
mehr...
Veranstaltet vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs gemeinsam mit Kathol.-theolog. Fakultät der Universität Wien und dem Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Wien
|Programm|
|Tagungsbericht|
...weniger
Mahnmal Viehofen
Podiumsdiskussion
24. November, 20.00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pölten
mehr...
Ausgangspunkt der Veranstaltung sind die zwei Arbeiten von Catrin Bolt und Tatiana Lecomte, die im Zuge der Ausschreibung zu einem Mahnmal Viehofen entstanden sind. Sie geben Anlass, aktuelle und tradierte Formen des Mahnmals zu diskutieren, sowie einen kritischen Blick auf die Erinnerungskultur in Österreich zu richten.
Moderation: Dr. Peter Huemer
Es diskutieren: Mag. Catrin Bolt, Dr. Martha Keil, Prof. Hans Kupelwieser, Dr. Susanne Neuburger, Dr. Heidemarie Uhl, Mag. Manfred Wieninger, (Mag. Tatiana Lecomte)
...weniger
Mahnmal Viehofen
Eröffnung
von Catrin Bolt und Tatiana Lecomte
Sonntag, 14. November 2010, 14.30
Lokal "Seedose" beim Viehofner See, St. Pölten
Shuttlebus von Wien nach Viehofen: ab Wien, Universität, Grillparzerstrasse / Ecke Rathauspark. Abfahrt: 13.00 Uhr, Rückfahrt: ca. 17.00 Uhr.
Um Anmeldung unter 02742 9005 16273 wird gebeten.
Umkostenbeitrag: 5 EUR
mehr...
In den Jahren 1944 und 1945 gab es in St. Pölten - Viehofen ein Zwangsarbeitslager für ungarische Juden und Jüdinnen sowie ein Arbeitslager für so genannte Ostarbeiter. 60 Jahre lang wurde die Existenz dieser Lager verdrängt und verschwiegen. Heute befindet sich auf dem Gelände der Viehofner See, der von zahlreichen BewohnerInnen der Stadt St. Pölten als Freizeitareal genutzt wird. Um diesen vergessenen Teil der Geschichte in Erinnerung zu rufen, wurde 2009 von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich zusammen mit der Stadt St. Pölten und unter Mitwirkung des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs ein offener Wettbewerb zur Erlangung eines künstlerischen Entwurfs für ein Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten – Viehofen ausgeschrieben. Aus den über 160 Einreichungen wurden vom Gutachtergremium die Entwürfe von Catrin Bolt und Tatiana Lecomte als Siegerprojekte ausgewählt. Nun werden beide umgesetzten Projekte präsentiert und eröffnet.
Neben der bereits bestehenden umfangreichen Homepage wird ein Folder mit weiterführender Information produziert, der ab der Saison 2011 in dem Gelände rund um die Viehofner Seen aufliegen wird. Weiters findet noch im November ein Diskussionsabend zur Erinnerungskultur in Österreich und der Problematik von Mahnmalen statt.
Ausführliche Informationen unter www.mahnmal-viehofen.at
...weniger
Die jüdischen Gemeinden in Brünn und St. Pölten
Ausstellung
Foyer des Rathauses St. Pölten
Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag, 7.00 bis 17.00, Freitag, 7.00 bis 13.00
mehr...
Aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums der Stüdtepartnerschaft St. Pölten und Brünn ist von 13. November bis 10. Dezember 2010 eine Ausstellung zu den jüdischen Gemeinden der beiden Städte zu besichtigen.
...weniger
Zinsverbot und Judenschaden
Jüdisches Geldgeschäft im mittelalterlichen Aschkenas
20. Internationale Sommerakademie
7.-9. Juli 2010 Erste Bank Zentrum
Petersplatz 7
1010 Wien
mehr...
Kaum ein anderes Themenfeld der mittelalterlichen jüdischen Geschichte ist so sehr mit Vor- und Fehlurteilen behaftet wie das jüdische Geld- und Kreditgeschäft. Die mittelalterliche Lebensrealität wird in der heutigen Wahrnehmung häufig von Stereotypen überlagert, die sich in der langen Geschichte der Judenfeindschaft bis hin zum modernen Antisemitismus entwickelt haben. Ziel der Tagung ist es daher, die mittelalterliche Realität des jüdischen Geldgeschäfts anhand aktueller Forschungsergebnisse unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Die wirtschaftliche Rolle jüdischer Darlehen und die Auswirkungen, die diese Rolle auf die jüdischen Geldgeber hatte, wird der literarisch-propagandistischen Verarbeitung des Wuchervorwurfs im Mittelalter gegenübergestellt. Fragen zur technischen Abwicklung jüdischer Kredite werden ebenso behandelt wie die rechtliche Basis dieser Geschäfte im Spannungsfeld zwischen weltlicher Judenherrschaft, Kirchenrecht und innerjüdischen Rechtssätzen.
In Kooperatiom mit dem Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt und dem Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg, sowie den Wiener Vorlesungen/Wien Kultur. Mit freundlicher Unterstützung der Erste Bank.
|Programm|
...weniger
Erlebte Revolutin 1848/49
Das Tagebuch des Wiener jüdischen Journalisten Benjamin Kewall
von Wolfgang Gasser
Buchpräsentation
Unter Mitarbeit von Gottfried Glaßner (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 3), Oldenbourg Verlag, Wien-München 2010
Freitag, 18. Juni 2010, 18:00
Jüdisches Museum Wien
Dorotheergasse 11
Wien 1010
mehr...
Dieses Buch beinhaltet eine besondere Kostbarkeit: das aus dem Müll gerettete Tagebuch des Hauslehrers und Journalisten Benjamin Kewall, das die Zeit vom 27. August 1848 bis zum 31. Mai 1850 umspannt. Seine Schilderungen betreffen die Wiener Revolution 1848/49 sowie zahlreiche Episoden aus seinen Lebenswelten und seinem beruflichen und politischen Umfeld. Mit dieser Edition werden die im Original auf Deutsch mit hebräischen Lettern festgehaltenen Aufzeichnungen nun in deutscher Schreibweise veröffentlicht und damit einem breiten Publikum lesbar gemacht. Das Original wird künftig auf der Website der ÖNB (Link beim Katalogeintrag des Werks) zugänglich sein.
Programm
Begrüßung: PD Dr. Martha Keil
Es sprechen
Wolfgang Gasser zur Fundgeschichte,
Gottfried Glaßner zu Buch und Schrift,
Wolfgang Gasser zu Inhalt und Autor
Revolutionslied 1848
Manfred Pintar liest Einträge aus dem Tagebuch
...weniger
Erlebte Revolutin 1848/49
Das Tagebuch des Wiener jüdischen Journalisten Benjamin Kewall
Wolfgang Gasser
Buchpräsentation
Unter Mitarbeit von Gottfried Glaßner (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 3), Oldenbourg Verlag, Wien-München 2010
Montag, 7. Juni 2010, voraussichtlich um 18 Uhr im Dachsaal der Wiener Urania
mehr...
Präsentation des Buches von Wolfgang Gasser im Rahmen der Vorstellung derQIÖG-Reihe, in der das Tagebuch erschienen ist.
...weniger
Führung auf dem jüdischen Friedhof St. Pölten
mit PD Dr. Martha Keil
Montag, 31. Mai 2010, 18 Uhr
Forschungsfeld Judentum
27. - 28. Mai 2010
Europasaal, Edmundsburg
Mönchsberg 2, 5020 Salzburg
mehr...
Vorträge von
Dr. Eveline Brugger,
Dr. Wolfgang Gasser,
Dr. Eleonore Lappin-Eppel,
Dr. Christoph Lind,
Dr. Martha Keil,
Dr. Barbara Staudinger und
Dr. Birgit Wiedl
im Rahmen der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Jüdische Studien in Österreich (AGJÖ)
|Programm|
...weniger
Juden im Ersten Weltkrieg
Vortragsreihe des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs am
Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1, 1020 Wien, Beginn: jeweils 18.30
Koordination: Dr. Martha Keil
mehr...
Diese Vortragsreihe beschäftigt sich in Vorbereitung eines größeren Forschungsprojekts mit der jüdischen Perspektive des Ersten Weltkriegs, den die Historikerin Paula Hyman im Jahr 2001 als den „vergessenen Krieg in der jüdischen Geschichtsschreibung" bezeichnete. Jüdische Männer kämpften in ihren jeweiligen Armeen, jüdische Frauen gründeten zahlreiche Hilfsvereine, Rabbiner betreuten Soldaten im Feld und jüdische Familien flohen quer durch Mitteleuropa vor den feindlichen Armeen. Allen gemeinsam war eine völlig neue Fragestellung zu ihrer nationalen und religiösen Identität.
3.3.2010: Jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg
Dr. Eleonore Lappin-Eppel
10.3.2010: Die Jüdische Heimatfront in Wien und Niederösterreich
Dr. Christoph Lind
17.3.2010: Judentum und Krieg aus rabbinischer Sicht
Dr. Martha Keil
24.3.2010: Galizische Juden im Kriegsverlauf
Dr. Svjatoslav Pacholkiv
...weniger
Ist das jüdisch?
Jüdische Volkskunde im historischen Kontext
Tagung
19./20. November 2009
Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15-19
1080 Wien
Veranstalter:
Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten
Österreichisches Museum für Volkskunde, Wien
mehr...
Die Jüdische Volkskunde, um 1900 als Reaktion auf die veränderten Lebenssituationen und den Wandel der Werte und Normen in der jüdischen Gesellschaft ins Leben gerufen, trug bis in die 1930er Jahre wesentlich zur wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Verortung des Judentums bei. Nach der Schoa geriet sie in Mitteleuropa nahezu in Vergessenheit. Eine intensivere Auseinandersetzung mit dieser Disziplin fand in den deutschsprachigen Ländern erst in den 1980er Jahren statt, jüngere Forschungen stammen auch aus den USA und Israel.
Der wissenschaftlich-kategorisierende Blick der jüdischen (aber auch der nichtjüdischen) Volkskunde formulierte, was „jüdisch“ war, sammelte und archivierte Rituale und Bräuche, nicht zuletzt um sie in einer Zeit des Wandels jüdischen Lebens vor dem drohenden Vergessen zu bewahren. Vermeintlich marginale, heute nicht mehr in diesem Kontext behandelte Themengebiete gerieten dabei ebenso ins Blickfeld wie zu jener Zeit aktuelle volkskundliche Fragestellungen, so etwa die Frage nach der Authentizität des Ostjudentums.Die Tagung will einen Überblick über die gegenwärtige Forschungslandschaft geben, aber auch neue Forschungsimpulse diskutieren. Wissenschaftsgeschichtliche Überlegungen über Kontinuitäten und Wandel des Jüdischen im Spiegel der „Jüdischen Volkskunde“ sollen ebenso im Fokus stehen, wie einzelne ForscherInnen und SammlerInnen und deren unterschiedliche Zugänge zu alltagskulturellen Fragestellungen, zu Ritualen und Bräuchen und deren Rezeption, Deutungen und Kontextualisierungen.
Konzept und Organisation:
Birgit Johler (Österreichisches Museum für Volkskunde)
Barbara Staudinger (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
|Programm|
|Tagungsbericht|
Nachlesen und Nachhören auf |Ö1 Dimensionen|
...weniger
Willing Kasztner
Dokumentarfilm von Gaylen Ross USA/IL 2008
Sonntag, 15.11.2009, 16.45
Jüdische Filmwoche im Votivkino
Währingerstraße 12
1090 Wien
mehr...
Einleitung:
Eleonore Lappin-Eppel (Institut für jüdische Geschichte Österreichs)
Renate Meissner (Ethnologin, Judaistin, stellvertretende Gneralsekretärin und wissenschaftliche Leiterin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus)
...weniger
Individuum und Gemeinde
Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848
6.-8. Oktober 2009 in Trebitsch (CR)
Tagungsort: Museum der Böhmisch-Mährischen Höhe Trebitsch, Steinerner Saal
mehr...
Konzept und Organisation:
Gesellschaft für die Geschichte der Juden in der Czechischen Republik
Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten
Museum der Böhmisch-Mährischen Höhe Trebitsch
Organisatorische Mitarbeit:
Židovské muzeum v Praze (Jüdisches Museum Prag)
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových,
FF UP Olomouc (Kurt-und-Ursula-Schubert-Zentrum für judaistische Studien, Philosophische Fakultät der Palacký-Universität Olmütz)
Samuel-Steinherz-Stiftung, Nürnberg
Moravský zemský archiv v Brno (Mährisches Landesarchiv Brünn)
Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds
Ehrenschutz:
Botschafterin der Republik Österreich Dr. Margot Klestil-Löffler
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Helmut Elfenkämper
In der Stadt des einzigen vollständig erhaltenen Ghettos aus der Barockzeit mit seiner prächtigen Synagoge, der Judengasse und dem Friedhof widmet sich diese internationale Tagung der jüdischen Geschichte von Böhmen und Mähren in der Vormoderne. Sie umfasst grundlegende Themen wie Ansiedlungsprivilegien, Gemeindeordnungen und Berufsstruktur, aber auch rabbinisches Recht, religiöse Werke und Maßnahmen der jüdischen Aufklärung zur Förderung der weltlichen Bildung. Vor dem rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund werden einige wichtige Gemeinden – insbesondere der Veranstaltungsort – und bedeutende Persönlichkeiten vorgestellt. Sowohl im innerjüdischen Bereich als auch im Austausch mit der christlichen Umwelt reicht das Wirken dieser Hofjuden, Rabbiner, Pädagogen und Künstler über die Landesgrenzen hinaus. Führungen durch die Sehenswürdigkeiten von Trebitsch runden die Tagung ab.
|Programm|
...weniger
Die Stimme der Opfer
Erinnerungen ungarisch-jüdischer Zwangsarbeiter/innen an ihre Deportation nach Österreich
Vortrag von Dr. Eleonore Lappin-Eppel
25.9.2009 16.00-17.15 Panel
Literarisches Quartier Alte Schmiede
Schönlaterngasse 9
1010 Wien
Im Rahmen des internationalen Symposiums anlässlich des 25jährigen Bestehens der Theodor Kramer Gesellschaft
Mahnmal für die Zwangsarbeiterlager St. Pölten - Viehofen
Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zum offenen Wettbewerb
Montag, den 14. September 2009, 17.00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 23
100 St. Pölten
mit Entwürfen von Catrin Bolt, Matthias Braun, Ulrich Brüschke, Bernhard Cella, Judith Engelmeier, Tatiana Lecomte, Aron Itai Margula, Hansjörg Mikesch, Nicole Six & Paul Petritsch zusammen mit Jeanette Pacher, Ulla Rauter, Rene Rheims und Peter Sommerauer
mehr...
Im Februar 2009 wurde von der Stadt St. Pölten zusammen mit Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich ein offener Wettbewerb zur Erlangung eines künstlerischen Entwurfs für ein Mahnmal für die Zwangsarbeiterlager St. Pölten – Viehofen ausgeschrieben. In den Jahren 1944 und 1945 gab es in St. Pölten - Viehofen ein Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden und Jüdinnen sowie ein Arbeitslager für so genannte Ostarbeiter. 60 Jahre lang wurde die Existenz dieser Lager verdrängt und verschwiegen. Heute befindet sich auf dem Gelände der Viehofner See, der von zahlreichen BewohnerInnen der Stadt St. Pölten als Freizeitareal genutzt wird. Mit Hilfe eines künstlerischen Projekts wird versucht, diesen vergessenen Teil der Geschichte St. Pöltens ins Gedächtnis zurückzurufen.
Aus den über 160 Einreichungen wurden vom Gutachtergremium die Entwürfe von Catrin Bolt und Tatiana Lecomte ex aequo als Siegerprojekte mit jeweils € 4.000,- Preisgeld ausgewählt. Der dritte Preis mit € 2.000,- ging an Jutith Engelmeier. Im Zuge der Ausstellung im Stadtmuseum St. Pölten werden neben den Siegerprojekten weitere 9 Entwürfe, die in die engere Auswahlrunde aufgenommen wurden, gezeigt.
Catrin Bolt, 1979 in Kärnten geboren, in Wien lebend, greift in ihrem Entwurf die in Freizeitarealen zur Vermittlung von Informationen beliebten Orientierungstafeln auf. An stark frequentierten Orten zeigen diese den aktuellen Standort der BesucherInnen an, in diesem Fall jedoch auf einer Karte, die die Situation um die Viehofner Seen von 1944/45 wiedergibt. Der Künstlerin gelingt, die Aufmerksamkeit der BesucherInnen mit einer allgemein verständlichen und gewohnten formalen Sprache auf die Geschichte des Ortes zu ziehen, um dann einen Prozess der Erkenntnis über Irritation auszulösen.
Tatiana Lecomte, 1971 in Bordeaux geboren, in Wien lebend, wird an ca. 20.000 St. PöltenerInnen im Laufe eines Jahres von ihr selbst handgeschriebene Postkarten schicken, mit dem stereotypen Satz: „Ich bin gesund, es geht mir gut.“. Dies ist ein Satz, den die Insassen der Lager, wenn sie Postkarten schreiben durften, als Standardsatz vermerken mussten. Die Motive der Postkarten betreffen die in der Ausschreibung festgesetzten Orte: Viehofner See, Lager der ehemaligen Glanzstoffwerke und Massengrab am Friedhof.
Die Architektin Judith Engelmeier, 1981 in Dresden geboren, schafft 20 Stufen unter dem Wasserspiegel, einen kontemplativen Gedenkraum, der von drei Seiten vom See umspült ist. Sowohl räumlich, als auch akustisch entsteht auf diese Weise ein vom Alltag entrückter Ort. Lediglich eine rundum laufende Gedenkschrift offenbart den eigentlichen Zweck dieser künstlerischen Arbeit.
Die zwei Siegerprojekte sollen im Frühjahr 2010 umgesetzt werden.
Weitere Informationen finden Sie |hier|
...weniger
Kennen Sie Paltram?
Eine Zeitreise durch das jüdische St. Pölten
Veranstaltung zum Jubiläum 850 Jahre St. Pölten
Samstag, 12. 9. 2009, 19:30,
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
A - 3100 St. Pölten
Eintritt frei
mehr...
Seit dem Mittelalter wirkten jüdische Persönlichkeiten in St. Pölten, zum Wohl ihrer Gemeinde und der ganzen Stadt. Dieser Abend ist ein historischer und musikalischer Streifzug durch die Jahrhunderte, der ihre Geschichte mit den Werken jüdischer Komponisten verbindet.
Mit den Mitarbeiter/innen des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs und dem Trio ATURJA (Junko Tsuchiya, Klavier; Lukas Thenius, Violine; Taner Türker, Violoncello)
Programm
Herbert Zipper (1904 Wien-1997 Santa Monica): Dachau-Lied (Dachau 1938, Text: Jura Soyfer)
Viktor Ullmann (1898 Teschen-1944 Auschwitz): Aus dem Streichquartett Nr. 3 op. 46 (Theresienstadt 1943)
Christoph Lind: Vertreibung und Vernichtung
Alexander von Zemlinsky (1871 Wien-1942 Larchmont/New York): Andante aus dem
Klaviertrio d-moll op. 3 (Wien 1896)
Martha Keil: Die Gemeinde in der Blüte
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 Hamburg-1847 Leipzig): Molto allegro agitato aus dem Klaviertrio d-moll op. 49 (Leipzig und Frankfurt am Main 1839)
Birgit Wiedl: Die Anfänge der Gemeinde
Salamone Rossi (1550-1630 Mantua): Canzon à 4 & Gagliarda detta "La Zambalina"
Barbara Staudinger: Landjuden und Tolerierte
Guglielmo Ebreo (1420 Pesaro-1484 Florenz): Falla con misuras (La Bassa Castiglia)
Eveline Brugger: Kennen Sie Paltram?
Nachspiel: Sholom Secunda (1894 Russland-1974 New York): “Dos Kelbl” (New York 1940, Text: Aaron Zeitlin)
Hans Krása (1899-1944 Auschwitz): Aus der Kinderoper „Brundibár“ (Prag 1938, ab 1943 55 Aufführungen in Theresienstadt)
...weniger
Salondamen und Dienstboten
Jüdisches Bürgertum um 1800 aus weiblicher Sicht
19. Internationale Sommerakademie
5. — 8. Juli 2009
Veranstaltungsorte: Erste Bank, Wien 1, Petersplatz 7 (6. und 8. 7.)
Palais Mollard, Wien 1, Herrengasse 9 (7.7.)
Konzept und Organisation:
Martha Keil (INJOEST), Dieter Hecht, Stefanie Schüler-Springorum, Andreas Brämer (Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg)
Ehrenschutz: Leslie Bergman
Eine Anmeldung für die Vorträge der Sommerakademie ist nicht notwendig. Bitte beachten Sie die beiden verschiedenen Veranstaltungsorte.
Eintritt frei
mehr...
Die diesjährige Tagung vereinigt mehrere Themen und Fragestellungen: Frauen- und Geschlechtergeschichte, Geschichte der Unterschichten, Alltagsgeschichte und die jüdische Geschichte in Deutschland und Österreich am Vorabend der Emanzipation. Die kurze Periode zwischen den Toleranzpatenten 1782 und der Revolution 1848 ist ein enorm wichtiger Zeitabschnitt, der die späteren Entwicklungen zu Reformjudentum und moderner Orthodoxie entscheidend prägte. Die Auseinandersetzungen zwischen Orthodoxie und Modernität trugen maßgeblich auch gebildete Frauen mit, deren Salons ein Ort des Diskurses jüdischer und christlicher Intellektueller und Künstler zu den politischen und sozialen Fragen der Zeit waren. Ob der „Mythos des Salons“ allerdings von der Forschung aus verschiedenen Motiven idealisiert wurde, wird bei der Tagung kritisch diskutiert. Dass hier auch die Dienstboten, deren Arbeit die gesellschaftlichen Ereignisse erst ermöglichte, aus den Quellen sichtbar gemacht werden, ist ein Novum und Forschungsdesiderat.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der deutschen Juden (Hamburg)
Gefördert von: Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg, Erste Bank Wien Kultur, Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte der Juden e. V.
|Programm|
|Tagungsbericht|
...weniger
Gleich dem kleinen Häuflein der Makkabäer
Die jüdische Gemeinde in Simmering
von Herbert Exenberger. Hrsg. v. Eleonore Lappin-Eppel im Auftrag des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs in der Schriftenreihe „Jüdische Gemeinden“, Mandelbaum-Verlag, Wien 2009
Buchpräsentation
Donnerstag, 23.04.2009, 19.00
Bezirksmuseum Simmering
Festsaal des Amtshauses
Enkplatz 2
1110 Wien
mehr...
Vergeblich sucht man bei dem ersten Chronisten Simmerings, Ernst Carl Gatter, der im Jahre 1883 sein Buch „Denkwürdigkeiten der Gemeinde Simering in Niederösterreich“ präsentierte, nach Informationen über die damals schon größere jüdische Gemeinde dieses Orts. Immerhin waren, um hier zwei Beispiele anzuführen, 1863 der erste jüdische Bethausverein –die Israelitischen Betgenossenschaft – gegründet und 1875 eine jüdische Religionsschule eingerichtet worden.
Vor mehr als zwanzig Jahren begann Herbert Exenberger im Rahmen des Bezirksmuseums Simmering über die jüdische Bevölkerung zu recherchieren, bekam jedoch immer wieder die Frage zu hören: „Gab es denn überhaupt Juden in Simmering?“ Die meisten dieser Personen vermuteten Juden in Simmering nur auf den jüdischen Abteilungen des 1. und 4. Tores des Wiener Zentralfriedhofes. Andere wieder waren überzeugt, dass alle Juden reich wie Rothschild wären. Der Wunsch, solchen Fragen und Meinungen entgegenzutreten, bestimmte zunächst die Nachforschungen. Denn nur ganz wenige jüdische Familien Simmerings gehörten zum Großbürgertum, welche das Klischee der zerstörten jüdischen Gemeinde Wiens bestimmen, sie waren aber auch keine strenggläubigen Chassidim, sondern meist kleine Händler, Handwerker, Arbeiter und Gewerbetreibende. Enthalten sind Informationen über die jüdischen Vereine in Simmering, über die Bedeutung der Synagoge in der Braunhubergasse für das religiöse, geistige und kulturelle Leben der jüdischen Gemeinde, über die Auswirkungen und den Leidensweg der Simmeringer jüdischen Männer, Frauen und Kinder während der nazistischen Gewaltherrschaft bis hin zu symbolischen „Gedenktafeln“ für die Simmeringer Opfer der Shoah.
Thematisiert wird selbstverständlich auch die bedrückende soziale Situation vieler Simmeringer Juden, etwa in den Abschnitten „Hausierer – Kleinhändler –Tödler“ oder über die „Jüdischen Familien im Barackenlager Hasenleiten“.
Das Buch versteht sich als „Erinnerungszeichen“ an die Simmeringer jüdische Gemeinde, vergleichbar auch mit den jüdischen Memor-Büchern, die Wissen über zerstörte jüdische Gemeinden bewahren. Den erwähnten Simmeringer Jüdinnen und Juden soll ihre Identität wiedergegeben und ihre Namen der Vergessenheit entrissen werden.
...weniger
9. Gedenkfahrt nach Engerau
Vortrag von Dr. Eleonore Lappin
Sonntag, 29. März 2009
Abfahrt 8.00 Uhr, Rückkehr: ca. 18 Uhr
beim Mahnmal für die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter auf dem Friedhof von Petržalka (Engerau) / Bratislava und beim Gedenkstein für ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter auf dem Friedhof und im Kurpark von Bad Deutsch-Altenburg
Programm und weitere Informationen finden Sie |hier|
Die Kriegskassen voll jüdischem Geld?
Der Beitrag der österreichischen Juden zur Kriegsfinanzierung im Spätmittelalter
Vortrag von Dr. Birgit Wiedl
Freitag, 27. März 2009, 10:45
Senatssaal
Universitätsplatz 3/1
8010 Graz
im Rahmen der Tagung "Krieg und Wirtschaft" der Universität Graz und des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung (25.-27. März 2009)
Die Todesmärsche ungarischer Jüdinnen und Juden durch die Steiermark
Vortrag von Dr. Eleonore Lappin
30. Jänner 2009, 11.00–13.00
UhrKarl-Franzens-Universität Graz, Resowi-Zentrum
Universitätsstraße 15, 8010 Graz
mehr...
im Rahmen der Tagung "NS-Herrschaft in der Steiermark. Terror – Verfolgung – Widerstand"
Veranstalter:
Centrum für Jüdische Studien,
CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit,
Institut für Geschichte (Abteilung Zeitgeschichte),
Ludwig Boltzmann Institut für Gesellschafts- und Kulturgeschichte
Panel 5: NS-Terror: Verfolgung und Widerstand II
Gerald Lamprecht (Graz): Die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in der Steiermark
Michael Teichmann, Roman Urbaner (Graz): Die Verfolgung von Roma und Sinti in der Steiermark
Birgit Poier (Graz): Euthanasie in der Steiermark
Eleonore Lappin (Wien/St.Pölten): Die Todesmärsche ungarischer Jüdinnen und Juden durch die Steiermark
Der Beitrag kann |hier| nachgelesen und -gehört werden.
...weniger
Sonderlager für ungarische Juden
Vortrag von Dr. Eleonore Lappin im Rahmen des Workshops Lager im NS-Herrschaftssystem
Wiepersdorf, 22. und 23. Januar 2009
mehr...
22. Januar, 13.30 Uhr:
Lagertypen I
· Zwangsarbeitslager für Juden, Mario Wenzel
· Erweiterte Polizeigefängnisse und Polizeihaftlager, Elisabeth Thalhofer
· Lager für ausländische Zivil- und Zwangsarbeiter, Carina Baganz
· Durchgangslager, Angelika Königseder
Lagertypen II
· Sonderlager für ungarische Juden, Eleonore Lappin
· Jugendschutzlager, Beate Kosmala
· Lager der „Organisation Schmelt“, Andrea Rudorff
· Arbeitserziehungslager, Cord Pagenstecher
Regionen I
· Serbien, Holm Sundhaussen
· Kroatien, Maria Vulesica
· Weißrussland, Petra Rentrop
· Transnistrien, Svetlana Burmistr
...weniger
Deutsch-jüdische Presse und jüdische Geschichte
Buchpräsentation
15. Januar 2009, 18.30
Jüdisches Museum Wien
Dorotheergasse 11
1010 Wien
Eleonore Lappin, Michael Nagel (Hg.), Deutsch-jüdische Presse und jüdische Geschichte: Dokumente, Darstellungen, Wechselbeziehungen / German-Jewish Press and Jewish History: Documents, Representations, Interrelations, 2. Bde. Bremen 2008
Univ. Prof. Dr. Fritz Hausjell (Institut für Publizistik der Universität Wien) im Gespräch mit der Herausgeberin Dr. Eleonore Lappin (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten) und dem Herausgeber Univ. Prof. Dr. Michael Nagel (Institut für Deutsche Presseforschung der Universität Bremen)
mehr...
Die historische deutsch-jüdische Presse gewinnt in der aktuellen Forschung an Bedeutung. Zunehmend wird erkannt, dass diese Presse zeit ihres Bestehens innerhalb der jüdischen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat. Detailreich und differenziert forcierten die historischen jüdischen Zeitungen und Zeitschriften seit der Haskalah eine teils innerjüdische, teils in die Allgemeinheit zielende Diskussion um jüdische Belange auf den Feldern des politischen, des gesellschaftlichen, des religiösen und des kulturellen Lebens. Dem heutigen Leser erschließen sich in diesen Blättern die Ziele und Anliegen, das geschichtliche Verständnis und die Zukunftsvorstellungen des deutschen und des deutschsprachigen Judentums in anderen Ländern von der Aufklärung bis in die Gegenwart.
Das vorliegende zweibändige Werk bietet einen Überblick über zweihundert Jahre deutsch-jüdische Presse und jüdische Geschichte im deutschsprachigen Raum.
...weniger
Ungleichheiten
Judenrecht und jüdisches Recht in Spätmittelalter und Frühneuzeit
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
jeweils 18:30
mehr...
Das weite rechtliche und soziale Feld der „Ungleichheiten" war im Jahr 2008 Thema des Deutschen Historikertages. Wir nehmen die Idee auf und untersuchen anhand von vier Fragestellungen Ungleichheiten im Judenrecht - dem Recht, das die Obrigkeit über Juden verhängt - und im jüdischen, rabbinischen Recht. Es zeigt sich, dass je nach Standpunkt Recht als Ungleichheit empfunden wurde oder Ungleichheit von Vorteil sein konnte.
7. Jänner 2009: Dr. Eveline Brugger
Daz die verfluchten juden vil pezzer recht habent. Die Rechtsstellung der mittelalterlichen Juden aus christlicher Sicht
14. Jänner 2009: Dr. Barbara Staudinger
Gleich oder doch ungleich? Jüdische Kauffrauen in der Frühen Neuezeit
21. Jänner 2009: Dr. Martha Keil
Aguna (die „Verankerte") - Rabbinische Strategien gegen Härtefälle im Eherecht
28. Jänner 2009: Dr. Birgit Wiedl
In unser besunder scherm genommen haben ir leib und gut. Sonderprivilegien einzelner Juden im Spätmittelalter
...weniger
Vertriebenes Recht
Auswirkungen des Anschlusses 1938 auf die Rechtswissenschaften in Wien
25.11.2008, 16:30 - 20:00
Juridicum (Aula und Dachgeschoß)
Schottenbastei 10-16
1010 Wien
Veranstalter: Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien in Kooperation mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs und dem DÖW
mehr...
Am 25. November wird die Ausstellung mit dem Titel „Erinnerungen im Exil - Exiled Memories“ am Juridicum eröffnet. Es handelt sich dabei um Installationen von der in den USA lebenden Tochter eines 1938 geflüchteten Absolventen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
Die Veranstaltung dient auch der Vorbereitung auf eine Ringvorlesung im Sommersemester 2009, welche der Geschichte der Institute der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zwischen 1938 und 1945 gewidmet sein wird.
Programm
Aula
16:30h Begrüßung: Dekan O. Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer
16:45h Ansprache und Eröffnung: Bundesministerin für Justiz Dr. Maria Berger
17:00h Führung durch die Installation: Prof. Karen Frostig PhD, Lesley University & Visiting Scholar, Brandeis University
Dachgeschoß
17:45h Kaffeepause
18:15h Akademisches Programm: Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes; Hon.-Prof. Dr. Irmgard Griss, Präsidentin des Obersten Gerichtshofes
19:00h Lesung aus Zeitzeugnissen: Otto Tausig
19:45h Egon Wellesz · Streichquartettsatz: Streichquartett der Wiener Akademischen Philharmonie
...weniger
Zwischen Archiv und Synagoge
Max Grunwald als Rabbiner und Historiker
Vortrag von Dr. Barbara Staudinger
Im Rahmen des Symposiums "Die jüdische Gemeinde im Wien des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts"
16. November 2008
Misrachi-Haus
Judenplatz 8
1010 Wien
Widersprechen. 1938-2008
Sonntag, 9. 11., 18.30
Gedenken vor der ehemaligen Synagoge
Als sichtbares Zeichen können Sie vor dem Gedenkstein Grablichter aufstellen.
ab ca. 19.00
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2
3100 St. Pölten
Eintritt frei
mehr...
Zwischen 9. und 11. November 2008 jährt sich der Pogrom gegen Synagogen und jüdische Menschen zum 70. Mal.
Barbara Wolflingseder & Andre Blau präsentieren Literatur zum Gedenkjahr:
* Texte von Autoren der Zeit um 1938, deren Bücher später von den Nazi-Machthabern als „entartete Kunst"oder „undeutscher Geist" verboten und/oder verbrannt wurden.
* Texte der Nachkriegszeit, die sich gegen das „Vergessen" der NS-Vergangenheit und gegen das Verdrängendes immer gegenwärtigen, bedenklichen Nationalismus und Alltagsfaschismus richten.
* Texte von Autoren der Gegenwart, die sich mit den gerade heute wieder stärker werdenden Tendenzen zu Intoleranz und Diskriminierung auseinandersetzen.
Musik: Martina Cizek - Saxophon
...weniger
Mobile der Geschichte
Ein alternatives Konzept zur Vermittlung von Zeitgeschichte
7. November 2008, 9.30-13.30
Lokal VI, Parlament
|Programm|
1938. Auftakt zur Shoah in Österreich
Orte - Bilder - Erinnerungen
Buchpräsentation und Vortrag
4. November 2008, 19.00
stadtmuseumgraz
Sackstraße 18
8010 Graz
In Kooperation mit erinnern.at und dem Centrum für Jüdische Studien
mehr...
Dr. Eleonore Lappin (Historikerin, St. Pölten)
Dr. Michaela Raggam-Blesch (Historikerin, Wien)
Dr. Dieter J. Hecht (Historiker, Wien)
Dr. Heidemarie Uhl (Historikerin, Wien)
Nach 1945 fand die Erinnerung an die mehr als 65.000 österreichischen Opfer der Shoah lange Zeit kaum Eingang in das österreichische Geschichtsbewusstsein: Die Zweite Republik stellte sich selbst als „erstes Opfer" des Nationalsozialismus dar. Den Jüdinnen und Juden, die durch das NS-Regime verfolgt, vertrieben und ermordet wurden, eine Stimme zu geben, dem Gedächtnis an die Opfer der Shoah im Gedenkjahr 2008 Präsenz zu verleihen, ist ein Ziel der Publikation.
...weniger
Die „Wahrheit“ der Erinnerung
Jüdische Lebensgeschichten
Buchpräsentation Eleonore Lappin und Albert Lichtblau
Mittwoch, 29. Oktober 2008 18:30
Jüdischen Museum Wien
Dorotheergasse 11
1010 Wien
mehr...
Doron Rabinovici liest aus seinem Roman „Ohnehin".
Maria Ecker und Karin Stögner sprechen mit den Herausgebern Eleonore Lappin, Albert Lichtblau über ihre Erfahrungen bei Interviews mit jüdischen Überlebenden.
„Die ,Wahrheit' der Erinnerung" war ein Tagungstitel, der heftigere Reaktionen auslöste als erwartet. Denn damit wurde die Authentizität von Lebenserinnerungen in Frage gestellt — und dies gerade auf dem sehr heiklen und belasteten Gebiet der jüdischen Lebenserinnerungen und der Erinnerung an die Shoah. Die in diesem Band versammelten Beiträge wollen die Bedeutung der Lebenserinnerungen für die Forschung nicht schmälern, sie zeigen vielmehr die Spannbreite der Zugänge zu dem, was Forschende unter „Erinnerung“, „Gedächtnis“, Autobiographischem verstehen. Sie setzen diese Begriffe immer wieder in Relation zu dem Begriff der „Wahrheit“. Den inneren Kern der „Wahrheit der Erinnerung“ von verschiedenen Perspektiven aus kritisch zu beleuchten, war eines der Anliegen der Tagung. Erinnerung soll also keineswegs entwertet, sondern, im Gegenteil, ihr Stellenwert und somit ihre Bedeutung für die Zukunft sichtbar gemacht werden.
Mit Beiträgen von: Andrei Corbea Hoisie, Silvia Cresti, Maria Ecker, Armin Eidherr, Dieter Hecht, Johannes Hofinger, Wilma Iggers, Gerhard Jost, Eleonore Lappin, Albert Lichtblau, Renate Meissner, Karl Müller, Katalin Pécsi, Andrea Petö, Alexander von Plato, Michaela Raggam-Blesch, Josef Shaked, Karin Stögner, Niko Wahl
...weniger
Die Wurzeln des Zionismus
Von Moses Hess bis Theodor Herzl
Vortrag von Dr. Elenore Lappin
23. Oktober 2008, 16:00
Universitätscampus (ehemaliges AKH) Hörsaal D
im Rahmen der Ringvorlesung an der Universtität Wien
„60 Jahre Staat Israel - Aspekte aus Geschichte und Gegenwart"
Geschichte der Juden in Österreich
Sektion S des 25. Österreichischen Historikertags (16.-19.9.2008)
16. September 2008, 14:30-17:30
Ausstellungssaal der NÖ Landesbibliothek
Vorsitz: Dr. Martha Keil
mehr...
Eveline Brugger
„Minem herren dem hertzogen sein juden" - die Beziehung der Habsburger zu „ihren" Juden im spätmittelalterlichen Österreich
Barbara Staudinger
„Was braucht ein Jud einen Papagei?" Hofjuden zwischen Kulturtransfer und Judenhass in der Frühen Neuzeit
Christoph Lind
Gemeinderäte, Bürgermeister, Honoratioren? Juden im Öffentlichen Leben Niederösterreichs 1867-1938
|Programm|
...weniger
„Bei uns war ein wirklich jüdisches Leben“
Die Kultusgemeinde St. Pölten und ihre Vernichtung
Eröffnung der Dauerausstellung
Eröffnung und Festakt zum 20jährigen Bestehen des Instituts
Sonntag, 7. September 2008, 17:00
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Konzert der Gruppe Kohelet 3 (Linz): Balkangroove, Klesmer und Jazz, Slowenisch, Ukrainisch und Jiddisch, Musik vom Salzkammergut bis Georgien – eine höchst lebendige, rhythmische und beherzte Mischung: Ewa Hanushevsky: Altsaxophon, Lead-Vocals; Bohdan Hanushevsky: Akkordeon, Gitarre, Lead-Vocals; Kurt Edlmair: Klarinette, Vocals; Barni Girlinger: Trompete, Flügelhorn
Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie |hier|
Einen Beitrag von Martha Keil zur Ausstellung finden Sie |hier|
Für die Unterstützung der Ausstellung danken wir: Land Niederösterreich – Kultur, Stadt St. Pölten, Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Zukunftsfonds der Republik Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
...weniger
Die Willkür der Zahlen
Jubiläen und Gedenken in der jüdischen Geschichte
18. Internationale Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, 20 Jahre INJOEST 1988-2008
1.7. – 3. 7. 2008
BAWAG-PSK, Veranstaltungszentrum
Seitzergasse 2-4
Wien 1010
Konzept und Organisation: PD Dr. Martha Keil und Dr. Barbara Staudinger
mehr...
Das Institut für Geschichte der Juden in Österreich – seit 1.1.2008 genderneutral in „Institut für jüdische Geschichte Österreichs“ umbenannt – feiert heuer sein zwanzigjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist die diesjährige Sommerakademie dem Themenkreis Jubiläen, Erinnerung, Gedenken, aber auch Umdeuten und Verdrängen gewidmet. Da zufällig in die-sem Jahr die Zahl Acht mit einer entsprechenden Häufung von Gedenkjahren (1338, 1648, 1848, 1918, 1938, 1948…) auftritt, wollen wir auch diese „Willkür der Zahlen" an einigen Perspektiven der jüdischen Geschichte untersuchen. Mit interdisziplinärem Zugang sprechen beispielsweise ein Neurologe zum biologisch-psychologischen Mechanismus von Erinnerung und Vergessen, Kulturhistoriker/innen zur Funktion von Jubiläen und Erinnerungsritualen in der jüdischen Geschichte und Leiter von jüdischen Museen und Gedenkstätten zur Verortung von Gedächtnis. Mehrere Vorträge behandeln die Verdrängungsgeschichte des Nationalsozialismus in Österreich und die Wende von 1986.
|Programm|
Zum nachhören und -lesen in den |Ö1 Dimensionen |
...weniger
Salomon Rossi, ein jüdischer Barockkomponist
Konzert mit Einführung
Donnerstag, 5. Juni, 19.00 Uhr
ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 - St. Pölten
Gemeinsam mit dem Blockflötenconsort der Musikschule St. Pölten, Leitung: Mag. Hemma Geitzenauer; historische Einführung: Martha Keil
„Grüß mich Gott“
Christoph Wagner-Trenkwitz liest Karl Farkas und Fritz Grünbaum
Freitag, 16. Mai, 19:30
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Musikalische Gestaltung: Schüler/innen des BG Piaristengasse Krems, der Musikhauptschule Herzogenburg und des BRG/BORG St. Pölten
Ein Benefizabend für den Verein Young, x-point Schulsozialarbeit (www.young.or.at)
Eintritt: € 17.- Abendkassa, 15.- |mail: Vorverkauf|, 10.- Schüler/inn/en/Student/inn/en
...weniger
Jerusalem
Synagogalkonzert
Oberkantor Shmuel Barzilai (Wien) und das Vienna Klezmer Trio
Mittwoch, 14. Mai 2008, 19:30
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Der in Jerusalem geborene Shmuel Barzilai, Oberkantor am Stadttempel in Wien, singt traditionelle Synagogalmusik, aber auch jiddische Klesmer-Lieder und Songs aus Israel.
Sergy Bolotney, Violine
Alexander Shevchenko, Akkordeon
Maciej Golebiowski, Klarinette
Eintritt gegen Spende
...weniger
Führungen in St. Pölten
„Auf den Spuren der Juden in St. Pölten"
Dr. Christoph Lind
5.5. und 2.6. 2008, 19:00
„Der jüdische Friedhof St. Pölten"
Dr. Martha Keil
26.5., 18:00
1938. Auftakt zur Shoah in Österreich
Orte – Bilder – Erinnerungen
Hrsg. von Dieter J. Hecht, Eleonore Lappin, Michaela Raggam-Blesch, Lisa Rettl und Heidemarie Uhl, Milena Verlag Wien, 48 Seiten
Buchpräsentation
In Kooperation von: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Institut für jüdische Geschichte Österreichs
10. März 2008, 18.00
Theatersaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Sonnenfelsgasse 19
1010 Wien
mehr...
Grußworte
Univ.-Prof. Dr. Peter Schuster, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (angefragt)
Mag. Manfred Wirtitsch, BMUKK, Abteilung Politische Bildung, www.erinnern.at
Podiumsgespräch zum Jahr 1938
Eleonore Lappin und Heidemarie Uhl im Gespräch mit Jonny Moser und Otto Tausig
Jonny Moser, geboren 1925 in Parndorf, Burgenland, überlebte zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester mehrere ungarische Lager und zuletzt als Mitarbeiter von Raoul Wallenberg den Nyílas-Terror 1944/45. 1945 Rückkehr nach Österreich, lebt als Historiker in Wien.
Otto Tausig, geb. 1922 in Wien, 1939 Flucht mit dem Kindertransport nach England. Seine Eltern flohen nach Shanghai, wo der Vater 1943 starb, die Mutter kehrte 1947 nach Wien zurück. 1946-1956 Schauspielausbildung und erste Tätigkeit als Schauspieler und Regisseur in Wien, 1956 Übersiedlung nach Ostberlin und 1960 nach Zürich. Seit 1970 lebt und arbeitet Otto Tausig wieder als Schauspieler und Regisseur in Wien.
Weitere Informationen finden Sie |hier|
...weniger
Konzepte und Persönlichkeiten
Jüdische Geschichtsschreibung in Österreich
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
jeweils 18:30
mehr...
9. 1. 2008: Barbara Staudinger
Die Entdeckung der Hofjuden: Max Grunwald und Bernhard Wachstein
16. 1. 2008: Wolfgang Gasser
Erzieher, Journalisten und Gelehrte - Benjamin Kewall und Gerson Wolf (Vormärz, Revolution)
23. 1. 2008: Christoph Lind
Aron Tänzer und Hans Tietze: zwei jüdische Historiker im Vergleich. (19. und frühes 20. Jdht)
30. 1. 2008: Eleonore Lappin im Gespräch mit Prof. Jonny Moser
Forschungen zum Holocaust in Österreich
...weniger
„Wir sprangen viel weiter als sie!“
Juden, Antisemiten und Sport in der österreichischen Zwischenkriegszeit
Vortrag Dr. Martha Keil
14., 19. und 26. November 2007, Wien
Geschichte der Juden in Österreich
Buchpräsentation
16. Oktober 2007
Stadtmuseum Graz
Sackstraße 18
8010 Graz
Eveline Brugger, Martha Keil, Christoph Lind, Albert Lichtblau, Barbara Staudinger: Geschichte der Juden in Österreich, Verlag Ueberreuter, Wien 2006 (Reihe Österreichische Geschichte, hg. von Herwig Wolfram, Bd. 15).
Frauen und Frauenbilder
in der europäisch-jüdischen Presse von der Aufklärung bis 1945
Hrsg. von Eleonore Lappin und Michael Nagel
Buchpräsentation
11. Oktober 2007, 19.30
Jüdisches Museum Wien
Dorotheegasse 11
1010 Wien
mehr...
Das Buch und die ihm zugrundeliegende Konferenz waren eine Kooperation des Instituts für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten, und des Instituts Deutsche Presseforschung der Universität Bremen.
Eleonore Lappin und Michael Nagel (Hg.)Frauen und Frauenbilder in der europäisch-jüdischen Presse von der Aufklärung bis 1945. Edition lumière bremen, Bremen 2007, 285 S., ISBN 978-3-934686-46-5, € 39.80
...weniger
Schutzkreis und Fürbitten
Geburt und Tod bei Juden und Christen im mittelalterlichen Österreich
Vortrag von Martha Keil
11. Oktober 2007
Universität Wien, Campus
Veranstaltung zum Gedenken an Univ. Prof. DDr. Kurt Schubert
45 Bilder zum Frieden
Vernissage der Ausstellung
24. September 2007
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
In Zusammenarbeit mit der Botschaft des Staates Israel
mehr...
Von jüdischen, arabischen, drusischen und beduinischen Kindern aus Israel. Ein Projekt von Maureen Kushner, Israel 2000
Die Ausstellung lief von 25. 9. bis 5. 10. 2007.
Die New Yorker Lehrerin Maureen Kushner führte zwischen 1994 und 2004 mit hunderten israelischen Kindern und Jugendlichen aller Bevölkerungsgruppen Gesprächs- und Malworkshops durch. Die 45 farbenprächtigen Bilder bringen Ängste und Verletzungen der Kinder zum Ausdruck, aber auch ihre Anerkennung und Wertschätzung gegenüber anderen Religionen und Völkern. Gemeinsam ist ihnen die Hoffnung auf ein Leben in Frieden für alle.
...weniger
Neuland. Migration mitteleuropäischer Juden 1850-1920
17. Internationale Sommerakademie des Instituts für Geschichte der Juden in Österreich
1.-4. Juli 2007
BAWAG-P.S.K Kulturzentrum
Seitzergasse 2-4
1010 Wien
mehr...
Konzept und Leitung: Martha Keil, Peter Rauscher, Barbara Staudinger
Der Tagungsband zu dieser Sommerakademie wird 2009 erscheinen.
|Programm|
|Tagungsbericht|
...weniger
Von Baronen und Branntweinern
Ein jüdischer Friedhof erzählt
von Martha Keil
Buchpräsentation
30. 5. 2007, 18:30
Jüdisches Museum Wien
Dorotheegasse 11
1010 Wien
Martha Keil (Hrsg.): Von Baronen und Branntweinern. Ein jüdischer Friedhof erzählt. Fotografiert von Daniel Kaldori. Mandelbaum Verlag, Wien 2007.
Ein Them – zwei Perspektiven
Juden und Christen in Mittelalter und Frühneuzeit
von Eveline Brugger und Birgit Wiedl
Buchpräsentation
3. Mai 2007
Jüdisches Museum Wien
Dorotheegasse 11
1010 Wien
16. Mai 2007
Ehem. Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Renate Stockreiter, Lesung
Wien: Hemma Geitzenauer, Renaissanceblockflöten
St. Pölten: Blockflötenconsort der Musikschule St. Pölten, Leitung: Hemma Geitzenauer
Eveline Brugger, Birgit Wiedl (Hrsg.), Ein Thema - zwei Perspektiven. Juden und Christen in Mittelalter und Frühneuzeit. StudienVerlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2007.
...weniger
„Alles Liebe, Deine Hannah!“
Ein Abend zum Gedenken an die jüdisch-deutsche Philosophin Hannah Arendt (1906-1975)
8. Mai 2007
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Linde Prelog, Lesung
Margarethe Deppe, Violoncello
Gefördert vom Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus
...weniger
Unterwegssein
Jüdische Mobilität vom Mittelalter bis zum Ersten Weltkrieg
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
jeweils 18:30
mehr...
8.1. 2007: Eveline Brugger, Birgit Wiedl
„Seu mügen umb iren frum gewandeln" - jüdische Geschäftsmobilität im mittelalterlichen Österreich
15.1. 2007: Martha Keil
Mobilität und Sittsamkeit: Jüdische Geschäftsfrauen im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit
22. 1. 2007: Christoph Lind
Aus Böhmen, Mähren und Ungarn - Jüdische Zuwanderung nach Niederösterreich im 19. Jahrhundert
29.1. 2007: Eleonore Lappin
Erzwungene Mobilität: Jüdische Kriegsflüchtlinge im Ersten Weltkrieg
...weniger
Geschichte der Juden in Österreich
Buchpräsentation
30. November 2006, Salzburg
mehr...
Begrüßung und einführende Worte:
Univ. Prof. Dr. Gerhard Langer (Zentrum für jüdische Kulturgeschichte)
Mag. Alfred Schierer (Verlag Uberreuter)
Em. Univ. Prof. Dr. Herwig Wolfram (Herausgeber)
Zum Werk:
Univ. Prof. Dr. Albert Lichtblau
Vladimir Vertlib liest eigene Texte zum Thema
Musikalisches Rahmenprogramm:
Georg Winkler (Saxophon), Hubert Kellerer (Akkordeon)
Eveline Brugger, Martha Keil, Christoph Lind, Albert Lichtblau, Barbara Staudinger: Geschichte der Juden in Österreich, Wien 2006 (Reihe Österreichische Geschichte, hg. von Herwig Wolfram, Bd. 15).
...weniger
Geschichte der Juden in Österreich
Buchpräsentation
30. Oktober 2006
Österreichische Nationalbibliothek
Heldenplatz
1010 Wien
mehr...
Begrüßung und einführende Worte:
Dr. Fritz Panzer (Verlag Ueberreuter)
Stadtrat DDr. Andreas Mailath-Pokorny
Em. Univ. Prof. Dr. Herwig Wolfram (Herausgeber)
Zum Werk:
Dr. Martha Keil
Sektionschef a. D. Dr. Raoul Kneucker
Musikalisches Rahmenprogramm:
Prof. Felix Lee, Akkordeon, spielt jüdische Wienerlieder
Eveline Brugger, Martha Keil, Christoph Lind, Albert Lichtblau, Barbara Staudinger: Geschichte der Juden in Österreich, Wien 2006 (Reihe Österreichische Geschichte, hg. von Herwig Wolfram, Bd. 15).
...weniger
Europäischer Tag der jüdischen Kultur
3. September 2006
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Israelisches Buffet israelische und jüdische Tänze
Ausstellung
Ensemble Klesmer Wien (Leitung: Leon Pollak)
...weniger
Die „Wahrheit“ der Erinnerung. Jüdische Lebensgeschichten
16. Internationale Sommerakademie des „Instituts für Geschichte der Juden in Österreich" in Zusammenarbeit mit dem „Zentrum für jüdische Kulturgeschichte" der Universität Salzburg
2.- 5. Juli 2006
BAWAG Veranstaltungszentrum
Hochholzerhof
1010 Wien
Der Tagungsband zu dieser Sommerakademie wird 2008 erscheinen.
|Programm|
Die jüdische Gemeinde in Wien im 17. Jahrhundert
Symposium der Misrachi Österreich
24. Mai 2006, Misrachi-Haus, Wien
mehr...
Dr. Martha Keil, Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten:
Politische Geschichte und Siedlungsgeschichte der Wiener jüdischen Gemeinde im 17. Jahrhundert.
Univ.Prof. Schlomo Spitzer, Bar Ilan-Universität, Israel:
Die rabbinischen Persönlichkeiten der Wiener jüdischen Gemeinde im 17. Jahrhundert
Univ. Doz. Meir Rappler, Bar Ilan-Universität, Israel:
Lebensweg, Persönlichkeit und Wirken des „Tossafot Jom Tov"- Rabbiner Jomtov Lipman Heller
Rav Joseph Pardess, Rabbiner der Misrachi, Wien:
Die juristisch-halachische Verbindlichkeit der testamentarischen Verfügung des „Tossafot Jomtov" an seine Nachfahren, den Tag seiner Befreiung aus dem Gefängnis als Feiertag zu begehen.
Dr. Peter Rauscher, Universität Wien:
Die Vertreibung der Juden aus Wien und Niederösterreich im Jahr 1670
Dr. Milka Zalmon, Elkana, Israel:
Der Weg der vertriebenen Juden - die Gründung neuer Gemeinden („Schewa Kehillot")
...weniger
Im Gedenken an die Opfer
Buchpräsentation und Konzert
16. Mai 2006
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Eleonore Lappin, Susanne Uslu-Pauer, Manfred Wieninger:
Ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter/innen in Niederösterreich 1944/45
Studien und Forschungen aus dem NÖ Institut für Landeskunde, hg. von Willibald Rosner und Reinelde Motz-Linhart, Band 45. St. Pölten 2006
Konzert
Streichensemble BogenGänge
Pauken: Margit Schoberleitner
Violoncello: Taner Türker
Leitung: Lukas Thenius
...weniger
Lehren und Lernen im mittelalterlichen Judentum
Vortrag Dr. Martha Keil
Im Rahmen der Ringvorlesung „Bildung und Lernen im Lauf der Geschichte"
27. April 2006, Universität Wien
Denkmale
Jüdische Friedhöfe in Wien, Niederösterreich und Burgenland
Hrsg. von Martha Keil, Elke Forisch und Ernst Scheiber
Buchpräsentation
Club Niederösterreich 2006
5. April 2006
Altes Wiener Rathaus, Festsaal
Herrengasse
1010 Wien
Wie jüdisch war der Rabbi?
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
mehr...
In europäischen, amerikanischen und israelischen Spielfilmen werden zunehmend Themen und Probleme von Jiddishkeit, Judentum und jüdischer Religion dargestellt. Das erfolgt in Komödien, historischen Dramen und Filmen, die sich mit zeitgenössischen Fragen jüdischen Lebens und jüdischer Identität befassen. An drei Abenden wird ein Überblick mit zahlreichen Filmbeispielen vom frühen Wiener Filmschaffen über Hollywood und Tel-Aviv gegeben.
1. März: Dr. Eleonore Lappin
Das Shtetl in New York: „Hester Street", „The Chosen", „Enemies, A Love Story"
8. März: Univ. Prof. Dr. Frank Stern
East meets West: Die Begegnung zwischen Juden aus Osteuropa und akkulturiertem Wiener Judentum im Film
29. März
Tabus im israelischen Film: Der Alltag der jüdischen Religion
...weniger
Jüdisches Lernen und Schulwesen in Österreich vom Mittelalter bis zur Shoah
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
mehr...
10. 1.: Dr. Martha Keil
Peitsche und Pilpul: jüdischer Unterricht im Mittelalter
17. 1.: Dr. Christoph Lind
Jüdischer Unterricht am flachen Land: Niederösterreich von 1850 bis 1940
24. 1.: Dr. Barbara Staudinger
Von Wien nach Prag und zurück: jüdischer Unterricht in der Frühen Neuzeit
31. 1.: Dr. Eleonore Lappin
Zionistische Jugenderziehung in Wien
...weniger
Gedenken vor der Ehemaligen Synagoge St. Pölten
10. November 2005
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
„Gantze Dörffer voll Juden“
Juden in Niederösterreich 1496-1670/71
von Barbara Staudinger
Buchpräsentation
10. Oktober 2005
Jüdisches Museum Wien
Dorotheegasse 11
1010 Wien
mehr...
Barbara Staudinger: „Gantze Dörffer voll Juden". Juden in Niederösterreich 1496-1670/71. (Geschichte der Juden in Niederösterreich von den Anfängen bis 1945, Band 2), Mandelbaum Verlag, Wien 2005
...weniger
Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter
von Eveline Brugger, Birgit Wiedl
Buchpräsentation
6. Oktober 2005, Kleiner Festsaal der Universität Wien
mehr...
Begrüßung:
Dr. Martha Keil (Institut für Geschichte der Juden in Österreich)
Dr. Martin Kofler (Studien Verlag Innsbruck)
Vorträge:
Univ. Prof. Dr. Karl Brunner (Institut für Österreichische Geschichtsforschung)
„ein entsagungsvolles und langwieriges Unternehmen"
Dr. Eveline Brugger, Dr. Birgit Wiedl
„Mit urkund dez iudischen priefs"Jüdische Urkunden und Judenurkunden im mittelalterlichen Österreich.
Eveline Brugger, Birgit Wiedl: Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter. Band 1: Von den Anfängen bis 1338. Hrsg. vom Institut für Geschichte der Juden in Österreich. StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen 2005.
...weniger
Europäischer Tag der jüdischen Kultur
Sonntag, 4. September 2005
mehr...
Programm:
Stadtführung mit Dr. Christoph Lind: Das jüdische St. Pölten
Jüdische Tänze mit Ulli Bixa
Ausstellung "Was habt Ihr da für einen Brauch?"
Israelisches Buffet mit Pita und Humus
Vernissage: Ölbilder von Sidonie Kohn (St. Pölten)
Jiddische Musik mit dem Ensemble Klesmer Wien
...weniger
Ein Thema - zwei Perspektiven
Juden und Christen in Mittelalter und Frühneuzeit
15. Internationale Sommerakademie des Instituts für Geschichte der Juden in Österreich
3.- 6. Juli 2005
BAWAG Veranstaltungszentrum
Hochholzerhof
1010 Wien
Der Tagungsband zu dieser Sommerakademie ist 2007 im Studienverlag, Innsbruck-Wien-Bozen, erschienen.
|Tagungsbericht|
Things, Places, Years
Dokumentarfilm, Österreich 2004
29. Juni 2005, Cinema Paradiso, St. Pölten
Regie: Klub Zwei (Simone Bader & Jo Schmeiser), 70 min
Verfolgung, Vertreibung und (kein) Neubeginn
Jüdische Schicksale in Niederösterreich
Vortragsreihe zum „Gedankenjahr“ 2005
Institut für Geschichte der Juden in Österreich
mehr...
23. Mai 2005: Dr. Martha Keil
Flucht und Deportation. Lena Rothstein liest Erinnerungen von Überlebenden
30. Mai 2005: Rückkehr in die fremde Heimat
Dr. Eleonore Lappin im Gespräch mit Zeitzeugen/innen
6. Juni 2005: Dr. Christoph Lind
St. Pölten und seine Juden 1945-1955
13. Juni 2005: Zeitzeugengespräch mit Prof. Leon Zelman
Dr. Eleonore Lappin: Nicht nur in Viehofen. Ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter/innen in Niederösterreich (1944/45)
20. Juni 2005: Szenische Lesung aus den Tagebüchern von Anne Frank und Josef Goebbels. Paul Sieberer, Verein „Die Welt der Anne Frank"
Gefördert von der Stadt St. Pölten und vom Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus
...weniger
Speak low – „unerwünschte“ Musik
Konzert
Mittwoch, 27. April 2005, St. Pölten
mehr...
Mit Georg und Stefan Buxhofer, Erika Foramitti, Andreas und Christian Gruber
Konzept und Leitung: Johannes Kammerer, Stefan Kupsa
Begleitende Ausstellung: Arbeiten von SchülerInnen des BRG/BORG zum Thema „Vorurteile"
Gefördert von Merkwürdig. Eine Veranstaltungsreihe wider Gewalt und Vergessen und dem Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus
...weniger
Von Sodom nach Casablanca – Von Wien nach Hollywood
Jüdische Perspektiven im (nicht immer) Wiener Film
Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
In Kooperation mit dem Filmarchiv Austria
mehr...
8. März 2005: Univ.Prof. Dr. Frank Stern
Moses in Wien und Freud in Sodom (Vortrag mit zahlreichen Filmausschnitten)
15. März 2005: Univ.Pof. Dr. Frank Stern
Von der Synagoge auf die Leinwand (Vortrag mit zahlreichen Filmausschnitten)
5. April 2005: Dr. Eleonore Lappin
Casablanca - Jüdische EmigrantInnen in Hollywood (Einleitung und Vorführung des Films)
...weniger
Das Burgenland im Jahr 1945
30.03.2005 - 31.03.2005
Stadtschlaining
PI - LehrerInnenfortbildung 2005
Zielgruppe: LehrerInnen Geschichte
Leitung: OSTR. Dr. Hugo Huber
mehr...
Inhalt:
Südostwallbau - Zwangsarbeitereinsatz
Kriegsende (Befreiung und Besatzung)
Wiederaufbau des Burgenlandes
Entnazifizierung
Exkursionen nach Rechnitz, Deutsch Schützen und Bildein
Referenten:
Dr. Gerhard Baumgartner
Dr. Eleonore Lappin
Dr. Anton Fennes
Dr. Herbert Brettl
...weniger
Quellen zur mittelalterlichen jüdischen Geschichte im Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Vortrag von Eveline Brugger und Birgit Wiedl
Im Rahmen der Reihe „Aus der Werkstatt der Forschung"
15. März 2005
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
Minoritenplatz 1
1010 Wien
Hitlers Tischgespräche aus dem Führerhauptquartier
Aufzeichnungen von Holocaust-Opfern
Musik aus den Konzentrationslagern
mit Iris Berben
12. Februar 2005, 20:00
VAZ St. Pölten
mehr...
Sprecherin: Iris Berben
Musik: N.N.
Buch und Regie: Carlo Rola
Idee und Konzept: Christian Reinisch
Produktion: Carpe artem
In Kooperation mit Cinema Paradiso
„Es reicht nicht zu sagen, wir sind gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierungen etc. Wir müssen diese Haltung leben!", so Iris Berben, die seit Jahren gegen Menschenverachtung aktiv (auch künstlerisch) ankämpft.
Für diesen Einsatz wurde sie 2002 mit dem „Bambi für Zivilcourage" sowie dem „Leo Beck-Preis" (der höchsten Auszeichnung des Zentralrates der Juden) ausgezeichnet. 2003 wurde sie vom „Time Magazin" als „Heldin Europas" für Ihr Engagement geehrt, zudem erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.
...weniger
Geschichte der Juden in Niederösterreich von den Anfängen bis 1945
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
mehr...
Das Institut stellt mit dieser Vortragsreihe die Forschungsarbeiten zu einer geplanten vierbändigen Geschichte der Juden in Niederösterreich vor; der vierte Band, 1938-45, erschien im November 2004 im Verlag Mandelbaum.
12. Jänner 2005, Dr. Eveline Brugger und Dr. Birgit Wiedl
Zwischen Privilegierung und Verfolgung - jüdisches Leben im mittelalterlichen Niederösterreich
19. Jänner 2005, Dr. Peter Rauscher
„Gantze Dörffer voller Juden. Landgemeinden in Niederösterreich im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges
26. Jänner 2005, Dr. Martha Keil und Dr. Christoph Lind
Vom Toleranzpatent bis zum „Anschluss": ein Projekt
2. Februar 2005, Dr. Christoph Lind
„… der letzte Jude hat jetzt den Tempel verlassen". Die Juden Niederösterreichs 1938-45
...weniger
Jüdisches Leben in der Presse
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
mehr...
17. 11. 2004, Dr. Dieter Hecht
Jüdische Frauen erobern die Österreichische Presse
24. 11. 2004, Dr. Eleonore Lappin
„Ein politischer Faktor": Jüdische Minderheitenpolitik während des Ersten Weltkriegs und bei der Friedenskonferenz
15. Dezember 2004, Dr. Louise Hecht
Jüdische Erziehung in der Presse der Haskalah
...weniger
Martin Buber - Denken und Wirken. Eine Retrospektive
Internationale Tagung
2.-5. Dezember 2004, Wien
mehr...
Organisatoren:
Hermann-Cohen-Akademie für Religion, Wissenschaft und Kunst, Buchen/Odenwald
Verein zur Erforschung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen und ihrer Aufarbeitung, Wien
In Kooperation mit:
Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten
Institut für Philosophie der Universität Wien
Institut für Zeitgeschichte der Universität WienMartin-Buber-Gesellschaft, Heidelberg
...weniger
„...die ganze befreite Judengemein alhie...“
Jüdisches Leben in Wien im 16. und frühen 17. Jahrhundert
Vortrag von Peter Rauscher
Im Rahmen der Vortragsreihe des Vereins für Geschichte der Stadt Wien
1. Dezember 2004
Bezirksmuseum Josefstadt
1080 Wien
„Der letzte Jude hat den Tempel verlassen“
Juden in Niederösterreich 1938 -1945
von Christoph Lind
Buchpräsentation
Montag, 22. November 2004
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
Präsentation des Kunstprojekts der Lernwerkstatt „Geschichte Erinnern"
Leitung: Renate Stockreiter
Christoph Lind: „Der letzte Jude hat den Tempel verlassen". Juden in Niederösterreich 1938 -1945. Mandelbaum Verlag, Wien 2004
...weniger
„Der letzte Jude hat den Tempel verlassen“
Juden in Niederösterreich 1938 -1945
von Christoph Lind
Buchpräsentation
17. November 2004
Jüdisches Museum der Stadt Wien
Dorotheergasse 11
1010 Wien
mehr...
Gemeinsam veranstaltet mit der Zeitschrift „morgen. Kultur. Niederösterreich. Europa"
Christoph Lind: „Der letzte Jude hat den Tempel verlassen". Juden in Niederösterreich 1938 -1945. Mandelbaum Verlag, Wien 2004
...weniger
Wien – Prag – Hollywood: Juden und Film
Buchpräsentation
15. November 2004
Jüdisches Kulturzentrum Graz
David-Herzog-Platz 1/1
8010 Graz
mehr...
Impulsreferate und Bildbeispiele: Dr. Michael John (Historiker, Universität Linz), Dr. Eleonore Lappin (Historikerin, Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten), Dr. Albert Lichtblau (Historiker, Universität Salzburg und Mitglied des Zentrums für Jüdische Kulturgeschichte, Salzburg)
...weniger
Zeitzeugengespräch - Veranstaltung der Lernwerkstatt
9. November 2004
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner Promenade 22
3100 St. Pölten
Zeitzeugengespräch von Simone Bruckner und Matthias Krepp (Absolventin bzw. Schüler des BRG/BORG) mit Gerhard Bronner
Juden zwischen Kaiser, Landesfürst und lokaler Herrschaft
Gemeinsamkeiten und Differenzen jüdischen Lebens im Süden des Alten Reichs
Tagung
22. - 24. Oktober 2004
Institut für Europäische Kulturgeschichte Universität Augsburg
Von Baronen und Branntweinern
Ein jüdischer Friedhof in Wien erzählt
von Martha Keil und Herbert Pasiecznyk
Buchpräsentation
14. Oktober 2004
Amtshaus Währing (Festsaal)
1018 Wien
mehr...
Das Institut für Geschichte der Juden in Österreich und der Mandelbaum Verlag präsentieren das Buchprojekt „Von Baronen und Branntweinern" - ein jüdischer Friedhof in Wien erzählt, hrsg. von Martha Keil und Herbert Pasiecznyk
...weniger
„Gantze Dörffer voll Juden in Oesterreich“
Zur Geschichte der niederösterreichischen Landjuden im 17. Jahrhundert
Vortrag von Peter Rauscher
13. Oktober 2004
Universität Wien, Institut für Geschichte
Grenzen und Grenzüberschreitungen
Kulturelle Kontakte zwischen Juden und Christen im Mittelalter
von Edith Wenzel
Buchpräsentation
5. Oktober 2004
Jüdisches Museum Wien
Dorotheegasse 11
1010 Wien
mehr...
Edith Wenzel (Hrsg.), Grenzen und Grenzüberschreitungen: Kulturelle Kontakte zwischen Juden und Christen im Mittelalter (Aschkenas 14/1)
...weniger
Langenlois
Eine jüdische Landgemeinde in Niederösterreich im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges
von Peter Rauscher
Buchpräsentation
30. September 2004
Im Weinlokal "Wein und Wasser"
1080 Wien
mehr...
Peter Rauscher, Langenlois. Eine jüdische Landgemeinde in Niederösterreich im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges (Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes Band 44) Horn, Waidhofen/Thaya 2004.
|Rezension|
...weniger
Juden und Film. Wien – Prag – Hollywood
Buchpräsentation
Sonntag, 19. September, 2004
Metro Kino
Johannesgasse 4
1010 Wien
mehr...
Juden und Film. Wien - Prag - Hollywood
Eleonore Lappin (Hrsg.)
Veranstaltet von:
Institut für Geschichte der Juden in Österreich
Mandelbaum Verlag
Filmarchiv Austria
...weniger
Frauen und Frauenbilder in der jüdischen Presse
14. Internationale Sommerakademie
4.-7. Juli, 2004, Wien
BAWAG Veranstaltungszentrum, Hochholzerhof
Seitzergasse 2-4
1010 Wien
mehr...
Institut für Geschichte der Juden in Österreich in Zusammenarbeit mit
Deutsche Presseforschung, Universität Bremen
Der Tagungsband zu dieser Sommerakademie ist 2005 im Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York, erschienen.
...weniger
Hofjuden und Landjuden
Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit
Hrsg. von Sabine Hödl, Peter Rauscher und Barbara Staudinger
Buchpräsentation
Mittwoch, 12. Mai 2004
Jüdisches Museum Wien
Dorotheegasse 11
1010 Wien
Namhaft im Geschäft – Unsichtbar in der Synagoge
Jüdische Frauen im Spätmittelalter
Vortrag von Martha Keil
Im Rahmen der Vortragsreihe „Geschichte am Mittwoch“ (Universität Wien)
Mittwoch, 21. April 2004, Universität Wien
Zionismus in Wien
Vortragsreihe am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
4 Vorträge (3., 10., 17. und 24. März)
„Mit urkund des iudischen priefs...“
Juden im mittelalterlichen Salzburg im Spiegel der Quellen
Vortrag von Eveline Brugger
Im Rahmen der Vortragsreihe der Freunde der Salzburger Geschichte
12. Dezember 2003, Salzburg
Ein kleines Jerusalem?
Die Langenloiser Juden im 17. Jahrhundert
Vortrag von Peter Rauscher
24. November 2003
Ursin Haus
Langenlois
Cultures of Conflict – Reflections on Middle East Dilemmas
13. Internationale Sommerakademie des Instituts für Geschichte der Juden in Österreich in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Internationale Politik - OIIP und Israel-Palestine Project Vienna
30. Juni - 2. Juli 2003
Eleonore Lappin, Institut für Geschichte der Juden in Österreich
John Bunzl, Österreichisches Institut für Internationale Politik - OIIP
Jewish Central Europe – Past. Presence / Juden in Mitteleuropa – Gestern. Heute
Ausgabe 2003, herausgegeben vom Institut für Geschichte der Juden in Österreich
Zeitschriftenpräsentation
12. Juni 2003
Kunsthistorischen Museum (Wien), Bassano-Saal
Maria Theresien-Platz 1
1010 Wien
Jewish Central Europe – Past. Present / Juden in Mitteleuropa – Gestern. Heute
Published by the Institut für Geschichte der Juden in Österreich
Presentation of the journal
June 5, 2003
The Südost-Europa Institut, Vienna-Budapest, the Institut für Geschichte der Juden in Österreich (Institute for the History of the Jews in Austria), the Hungarian Jewish Museum and Archive, and the Esther's Bag Workshop invited to the Hungarian Jewish Museum and Archive in Budapest.
Jewish Communities in the former Habsburg Monarchy
17th to 20th Century
Symposium
Cooperation of the Center for Jewish History 15 W 16th Street, New York City
the Skirball Department of Hebrew and Judaic Studies at New York University
the Leo Baeck Institute and
the Association for the History of Jews in Central Europe
Thursday, 20. March 2003
Geschichte der Juden in Niederösterreich von 1938-1945
Tagung
Mittwoch, 26. Februar 2003
Cinema Paradiso St. Pölten
Rathausplatz 14
3100 St. Pölten
Moderation
Dr. Eleonore Lappin, Institut für Geschichte der Juden in Österreich
Pressekonferenz in Prag
30. Jänner 2003
Österreichisches Kulturforum Prag
Jungmannova nam. 18, Prag 1
Vertragsunterzeichnung und Präsentation der Projekte Bohemia, Moravia et Silesia Judaica und Austria Judaica
mehr...
Veranstaltet gemeinsam mit dem Jüdischen Museum in Prag, der Archivverwaltung des Ministeriums für Inneres der Tschechischen Republik, der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Tschechischen Republik und dem Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut, Außenstelle Brünn.
Donnerstag, 30. Jänner 2003: Vortragsnachmittag in der KarlsuniversitätIm Großen Sitzungssaal der Karlsuniversität Ovocny trh 3, Prag 1 um 16 Uhr
Wir bedanken uns beim Institut für Internationale Studien der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität Prag für die Mitorganisation des Nachmittags.
...weniger
Jüdische Gemeinden – Kontinuitäten und Brüche
von Eleonore Lappin
Buchpräsentation
Dienstag, 26. November 2002
Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
Seitenstettengasse 2
1010 Wien
mehr...
Eleonore Lappin (Hrsg.): Jüdische Gemeinden - Kontinuitäten und Brüche. Berlin, Wien, Philo Verlag, 2002
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Statuts der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
...weniger
Gedenkveranstaltungen
anlässlich des Novemberpogroms in Niederösterreich
9. November 2002
10. November 2002
16. November 2002
17. November 2002
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22
3100 St. Pölten
mehr...
„Pogrom - Der Wirtschaftsthriller"
Von Thomas Gratzer
Szenische Lesung
Theater perpetuum
...weniger
Erlebte Geschichte – Fragen an Gott und Mensch
Vortrag von Moshe Jahoda, Leiter der Jewish Claims Conference in Österreich
Donnerstag, 14. November 2002
Senatssaal der Universität Wien
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
1010 Wien
Jewish Central Europe. Past – Presence/Juden in Mitteleuropa. Gestern – Heute
Ausgabe 2002
Präsentation der Zeitschrift
26. November 2002
Jüdisches Museum Wien
Dorotheergasse 11
1010 Wien
Hofjuden – Landjuden – Betteljuden
Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit
12. internationale Sommerakademie 2002
30. Juni - 4. Juli 2002
BAWAG-Veranstaltungszentrum, Hochholzerhof
Seitzergasse 2-4
1010 Wien
mehr...
Der Tagungsband zu dieser Sommerakademie erschien im Frühjahr 2004 im Philo-Verlag, Berlin-Wien. Hrsg. von Sabine Hödl, Peter Rauscher und Barbara Staudinger
Zum Nachhören und Nachlesen |Ö1 Dimensionen|
...weniger
„…sind wir doch in unserer Heimat als Landmenschen aufgewachsen…“
Jüdische Schicksale zwischen Wienerwald und Erlauf
von Christoph Lind
Buchpräsentation
Montag, 22. April 2002, Wien
Montag, 29. April 2002, St. Pölten
Minhagim – rituelle Bräuche der Juden im Mittelalter
Jänner 2002: Vortragsreihe am Institut für jüdische Erwachsenenbildung
Praterstern 1
1020 Wien
mehr...
Dr. Martha Keil:
Von der Wiege bis zur Bahre - Minhagim im Lebenszyklus
Der Festkreis zu Hause und in der Synagoge I
Der Festkreis zu Hause und in der Synagoge II
...weniger
Mein Schicksal war die Ausnahme
Erinnerungen eines Karikaturisten und Zeichners an Österreich, Ungarn und Israel
von Shemuel Katz
Buchpräsentation
Montag, 22. Oktober 2001, Wien
mehr...
Shemuel Katz: Mein Schicksal war die Ausnahme. Erinnerungen eines Karikaturisten und Zeichners an Österreich, Ungarn und Israel. Hg. von Martha Keil, Styria Verlag, ca. 180 Seiten, mit 80 Zeichnungen
...weniger
Jüdische Gemeinden – Kontinuitäten und Brüche
11. internationale Sommerakademie 2001
1. - 5. Juli 2001
BAWAG-Veranstaltungszentrum, Hochholzerhof
Seitzergasse 2-4
1010 Wien
Der Tagungsband zu dieser Sommerakademie erschien im Herbst 2002 im Philo-Verlag, Berlin.
„Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh“
Eine Überlebensgeschichte
von Marko M. Feingold
Buchpräsentation
Mittwoch, 2. Mai 2001, Wien
mehr...
Marko M. Feingold: „Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh". Eine Überlebensgeschichte. Hg. und mit einem Nachwort von Birgit Kirchmayr und Albert Lichtblau. Picus Verlag, Wien 2001
...weniger
Die Wehen des Messias
Zeitenwenden in der jüdischen Geschichte
Hrsg. von Eveline Brugger und Martha Keil
Buchpräsentation
Mittwoch, 23. Mai 2001, Wien
mehr...
Eveline Brugger, Martha Keil (Hg.), Die Wehen des Messias. Zeitenwenden in der jüdischen Geschichte. Philo-Verlag, Berlin - Wien 2001
...weniger
Renovierung der Zeremonienhalle
am jüdischen Friedhof St. Pölten
Festakt
Mittwoch, 8. November 2000
Jüdischer Friedhof St. Pölten
Karlstettner Straße 3
Präsentation der Broschüre „Geschichte wieder herstellen? St. Pöltens jüdische Vergangenheit"
Die Wehen des Messias
Zeitenwenden in der jüdischen Geschichte
10. Internationale Sommerakademie 2000
2. - 6. Juli 2000
Die Vorträge erschienen im Frühjahr 2001 im Philo-Verlag, Berlin - Bodenheim/Mainz, hrsg. von Eveline Brugger und Martha Keil.
Erinnerung als Gegenwart. Jüdische Gedenkkulturen
Hrsg. von Sabine Hödl und Eleonore Lappin
Buchpräsentation
2. Juli 2000, St. Pölten
mehr...
Sabine Hödl und Eleonore Lappin (Hrsg.), Erinnerung als Gegenwart. Jüdische Gedenkkulturen, Philo-Verlag, Berlin - Bodenheim/Mainz 2000.
...weniger
Buchpräsentation
Die Wiener Juden im Mittelalter
von Klaus Lohrmann
Die vierte Gemeinde. Die Wiener Juden in der Zeit von 1945 bis heute
von Evelyn Adunka
20. März 2000, Wien
In Kooperation mit dem Renner-Institut und dem Philo-Verlag, Berlin
Tagung
der Arbeitsgemeinschaft jüdischer Sammlungen
5. - 8. Oktober 1999
BAWAG-Veranstaltungszentrum, Hochholzerhof
Seitzergasse 2-4
1010 Wien
mehr...
Das jährliche Treffen deutschsprachiger jüdischer Museen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen fand 1999 zum ersten Mal in Wien statt, diesmal auch mit Teilnehmern aus Belgien, Israel und Ost- und Südosteuropa. In Plena und Workshops wurden die einzelnen Einrichtungen und Projekte vorgestellt und diskutiert.
...weniger
Erinnerung als Gegenwart. Jüdische Gedenkkulturen
9. Internationale Sommerakademie 1999
4.–8. Juli 1999
BAWAG-Veranstaltungszentrum, Hochholzerhof
Seitzergasse 2-4
1010 Wien
Die Vorträge erschienen im Frühjahr 2000 im Philo-Verlag, Berlin - Bodenheim/Mainz, hrsg. von Sabine Hödl und Eleonore Lappin.